Kommentar
Wenn die Rente mit der Wirtschaft wackelt
Nach der Reform ist vor der Reform. Nach der AHV-Abstimmung machen wir uns nun daran, die 2. Säule so zu reformieren, dass auch die Frauen auf eine existenzsichernde Rente hoffen können. Das ist zurzeit nicht der Fall. Der durchschnittliche Jahreslohn der Frauen, kombiniert mit Ihrem durchschnittlichen Arbeitspensum ergibt – selbst bei der maximalen Beitragsdauer – eine AHV-Rente von rund 2000 Franken. Dazu kommen noch rund 500 Franken aus der 2. Säule. Die Hälfte der Frauen hat somit einen Rentenanspruch von weniger als 2500 Franken.
Was tun? An Ideen mangelt es nicht. Zum einen soll der Koordinationsabzug sinken oder ganz weg. Konkret: Die BVG-Beiträge sollen möglichst auf dem ganzen Jahreslohns erhoben werden und nicht erst auf dem 25’095 Franken übersteigenden Teil. Im Idealfall steigt der monatliche Rentenanspruch damit nach 40 Jahren um rund 500 Franken. Doch auch das reicht kaum zum Leben und kommt zu spät. Um existenzsichernde Renten zu erreichen, müssen Frauen auch mehr arbeiten und verdienen können.
Mindestens 70 Prozent und 5000 Franken
Nach Einschätzung der Präsidentin der Pro Senectute, Altbundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, brauchen Frauen für eine halbwegs auskömmliche Altersrente ein 70-Prozent-Pensum. Helena Trachsel, Leiterin der Fachstelle Gleichstellung des Kantons Zürich, rät den Frauen, mit dem Arbeitgeber Lohnverbesserungen auszuhandeln, damit sie auch den Maximalbeitrag von 6883 Franken in die 3. Säule einzahlen können. Dafür sei ein monatliches Einkommen von mindestens 5000 Franken nötig.
Doch damit die Frauen deutlich mehr arbeiten und besser verdienen können als bisher, braucht es mehr und erschwingliche Kitas. Die SP sammelt deshalb zurzeit Unterschriften für Ihre Kita-Initiative. Danach «sollen Eltern höchstens 10 Prozent ihres Einkommens für die Kita-Plätze ihrer Kinder ausgeben müssen.» Unter dem Strich lautet die Lösung des Rentenproblems also: mehr sparen, mehr arbeiten, mehr Kitas.
PK-Gelder werden nicht real investiert
Klingt logisch oder gar zwingend. Doch mit dieser Lösung handeln wir uns zwei Probleme ein, die in der aktuellen Diskussion unverständlicherweise nicht beachtet werden. Zunächst stellt sich die Frage, ob die Wirtschaft überhaupt so viel mehr Ersparnisse braucht, bzw. ob sie damit etwas Sinnvolles anstellen kann. Die Antwort ist ein klares Nein. Zunächst: Die Schweiz spart eh zu viel. Jahr für Jahr erzielen wir Leistungsbilanzüberschüsse von 50 bis 60 Milliarden Franken, wovon etwa zwei Drittel aus den Netto-Ersparnissen der 2. Säule stammen. Die Gelder müssen wir – per Saldo – notgedrungen im Ausland und in Fremdwährungen anlegen – wo sie sich laufend entwerten. Mal schneller, mal langsamer. Zurzeit geht es wegen der Frankenaufwertung wieder mal sehr schnell. Siehe den aktuellen Jahresverlust der Nationalbank von 145 Milliarden Franken.
Dass die mittlerweile gut 1200 Milliarden Franken Pensionskassengelder in den letzten 20 Jahren dennoch anständig rentiert haben, hängt damit zusammen, dass sie – bevor sie im Ausland landen – erst noch ein paar Runden auf den Aktien- und Immobilienmärkten drehen und dort die Preise hochtreiben. Der Immobilienbesitz der Schweizer Haushalte ist dadurch allein in den letzten zehn Jahren um 850 Milliarden Franken aufgewertet worden. Dem stehen bloss etwa 50 Milliarden reale Nettoinvestitionen gegenüber. Per Saldo werden die Ersparnisse der 2. Säule also kaum real investiert. Aber sie geben den Pensionskassen einen Hebel in die Hand, um mehr aus den Mietern und aus den Arbeitnehmern herauszupressen. Sie sind damit ein Haupt- oder mindestens Nebenmotor einer grossen Umverteilungsmaschine. (Siehe dazu auf Infosperber «Noch mehr sparen schadet der Rente».)
Stellschraube des Wohlstands falsch gedreht
Das zweite noch grössere Problem mit der geplanten Reform liegt darin, dass wir damit eine für unser Wohlbefinden und unseren Wohlstand wichtige Stellschraube weiter in die falsche Richtung drehen. Gemeint ist die Aufteilung der nötigen Arbeitszeiten auf Erwerbsarbeit, Wegzeiten und unbezahlte Arbeit. In den vergangenen Jahrzehnten ist der Anteil der Erwerbsarbeit und damit der Wegzeiten laufend gestiegen.
Der Ablauf war immer derselbe: Eine bestimmte Gruppe – Frauen, Immigranten, Unqualifizierte – ist im Kampf um die schrumpfende Erwerbsarbeit benachteiligt. Um sie in Arbeit und Verdienst zu bringen, wird unbezahlte Arbeit (vor allem persönliche Dienstleistungen) in bezahlte umgewandelt. Um die nötige Nachfrage anzukurbeln, wird diese verbilligt. Etwa durch das Schaffen eines Niedriglohnsektors und durch staatliche Lohnzuschüsse. In Deutschland ist dadurch die Zahl der unbezahlten Arbeitsstunden zwischen 1992 und 2013 parallel zur höheren Beschäftigungsquote der Frauen um nicht weniger als 13 Prozent bzw. rund 13 Milliarden Jahresstunden geschrumpft.
Kitas – brauchen wir die wirklich?
Dass dies keine optimale Verwendung der knappen Ressourcen ist, zeigt das Beispiel der Kitas. Müssten wir für die Kita-Mitarbeiterinnen – wie es die SP fordert – existenz- und rentensichernde Löhne zahlen, würde ein Kind pro Tag nicht nur 120, sondern wohl 150 Franken Vollkosten verursachen. Für eine durchschnittlich verdienende Mutter entspräche das rund 4, für Väter etwa 3,5 Arbeitsstunden. Dazu kommen 1 bis 2 Stunden für das Bringen, Abholen, Schuhe und Mäntel an- und ausziehen etc. plus die Arbeitswege der Kita-MitarbeiterInnen.
Man könnte das Problem aber auch lösen, indem man die bezahlte Arbeit besser verteilt und die Normarbeitszeit der effektiv nötigen Arbeitszeit anpasst. Die Erwerbsarbeit würde dann nicht mehr nur wegen der steigenden Produktivität sinken, sondern auch in dem Ausmasse, wie Arbeit in den unbezahlten Bereich zurückverlagert wird. Wer weniger Geld ausgibt, etwa für Kitas und Transporte, muss auch weniger Erwerbsarbeit leisten. So könnte man die durchschnittliche Erwerbsarbeit auf – sagen wir – 25 bis 30 Wochenstunden senken.
Unbezahlte Arbeit braucht kurze Wege
Bisher haben wir – im Bestreben, mehr Jobs zu schaffen – die Rahmenbedingen für die bezahlte Arbeit ständig verbessert. Flexible Arbeitszeiten, Arbeit auf Abruf, lange zumutbare Arbeitswege, staatliche Lohnzuschüsse etc. Gleichzeitig haben wir dadurch aber auch die Rahmenbedingungen für die Produktionsstätten der unbezahlten Arbeit – Familien und Nachbarschaften – massiv verschlechtert. Jetzt geht es darum, sie wieder zu verbessern. Kürzere Normarbeitszeiten sind ein erster Schritt dazu.
Doch das reicht nicht. Unbezahlte Arbeit benötigt eine Wirtschaft der kurzen sozialen und räumlichen Distanzen. Das erfordert auch städte- und verkehrsplanerische Massnahmen. Es braucht gut durchmischte Nachbarschaften, in der sich auch Senioren und temporär Arbeitslose nützlich machen können und sozial integriert bleiben. Etwa indem sie Kinder hüten oder Unterhaltsarbeiten übernehmen. Wenn die Senioren dadurch länger fit bleiben, sinken auch die Pflegekosten. Auch Lokalwährungen und ein Bürgergeld könnten den Übergang zu einer Wirtschaft der kurzen Wege erleichtern.
In der Optik der gelernten Ökonomen hängt unser Wohlergehen allein von der Erwerbsarbeit ab. Je mehr BIP, desto besser. Deshalb ist für sie jede Stunde Erwerbsarbeit, die wir der unbezahlten Arbeit abringen, ein Fortschritt. Doch mehr BIP heisst vor allem noch mehr Produkte – und davon hängt unsere Lebensqualität immer weniger ab. Zudem wird die BIP-generierende Erwerbsarbeit durch Konkurrenz gesteuert und verursacht Stress. Auch davon haben wir allmählich zu viel. Unbezahlte Arbeit hingegen lebt von der Solidarität und von der räumlichen und sozialen Nähe. Sie befriedigt vor allem unsere sozialen Bedürfnisse, sie spart Wegkosten und schont damit die Umwelt.
So könnte ein zukunftssicheres Rentensystem aussehen
Vieles spricht deshalb dafür, dass wir unsere Lebensqualität und die Überlebenschancen verbessern können, wenn wir den Anteil der bezahlten Arbeit wieder zurückschrauben. Das setzt allerdings voraus, dass die Ökonomen und Wirtschaftspolitiker (männliche Form bewusst gewählt) erst einmal anfangen, darüber nachzudenken, wie man an dieser Stellschraube dreht. Die Wirtschaftspolitik kann nicht mehr nur an der Zins- und Fiskalschraube drehen.
In Bezug auf das Rentensystem könnte das zum Beispiel Folgendes bedeuten:
- Eine Normalrente muss mit einem durchschnittlichen Normalarbeitspensum (von z.B. 30 Stunden) plus angemessenen Erziehungsgutschriften erreicht werden können.
- Vom Rentensystem dürfen keine übertriebenen Sparanreize ausgehen – was für das Umlageverfahren spricht.
- Wie Eltern ihre Erwerbsarbeit aufteilen (z.B. Vater 80- Prozent- , Mutter 40-Prozentpensum) hat keinen Einfluss auf die individuellen Rentenansprüche.
- Das System soll eine bessere Verteilung der Arbeitslast auf das ganze Leben ermöglichen. Je höher das Rentenalter, desto tiefer können die Lohnprozente ausfallen.
Doch das ist nicht in Stein gemeisselt, sondern bloss ein Startschuss für eine längst überfällige Diskussion.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.





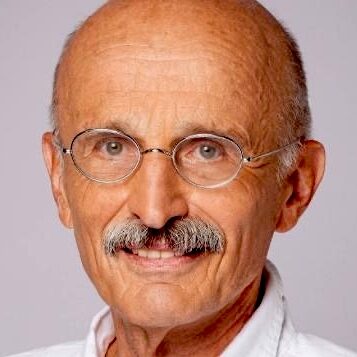





Wäre eine bedingungslose Existenzsicherung nicht auch ‹Teil der Lösung›?
https://www.grundeinkommen.de/08/10/2022/bge-ein-bindeglied-zwischen-care-und-klimabewegung.html