Wachstum frisst selbst im «Musterland» Schweiz Naturkapital
upg. Als Teil unserer Serie im Gedenken an Hanspeter Guggenbühl übernehmen wir seinen Artikel aus dem Jahr 2005 über das unsinnige Starren auf das Wirtschaftswachstum. Mit aktuellen Zahlen von heute könnte er die falschen Weichenstellungen noch schärfer darstellen. Trotzdem ist das BIP-Wachstum noch immer das oberste Ziel der Wirtschaftspolitik. Alle Beiträge werden als Serie «in memoriam hpg» zusammengefasst und im hier verlinkten Dossier vereint.
Das BIP-Wachstum ist weder «qualitativ» noch «nachhaltig»
Wir brauchen mehr Wirtschaftswachstum, um den Umweltschutz zu finanzieren, predigen die Regierungen der meisten Industriestaaten. Dabei übersehen sie einen einfachen Zusammenhang. Je mehr die Wirtschaft wächst, desto stärker schrumpft tendenziell das Kapital der Natur in Form von nicht erneuerbaren Ressourcen, und desto stärker wird die Umwelt mit Abfällen, Klimagasen und Landversiegelung belastet.
Das gilt in besonderem Mass für die Schweiz, wo der Dienstleistungssektor einen überdurchschnittlichen Anteil an die volkswirtschaftliche Wertschöpfung beisteuert: Der Übergang ins postindustrielle Zeitalter hat das Wachstum weder «qualitativ» noch «nachhaltig» gemacht, wenn man von einzelnen Erfolgen der Reinigungstechnik absieht. Denn die Steigerung der ökologischen Effizienz in der Produktion und in einzelnen Produkten wird durch eine zunehmende Ineffizienz und Verschwendung im Konsum mehr als kompensiert.
Führende Leute aus Politik und Wirtschaft behaupten, das Wachstum der Wirtschaft sei notwendig, um die Umwelt besser zu schützen. Zum Beispiel George W. Bush, Präsident der Nation, die weltweit am meisten Naturkapital verbraucht: «Wachstum ist nicht das Problem, sondern die Lösung, weil es der Schlüssel zu Fortschritten im Umweltschutz ist und die nötigen Ressourcen für Investitionen in saubere Technologie bereitstellt», erklärte Bush in einer Rede vor Meteorologen. Ins gleiche Horn stiess im Jahr 2003 der damalige Bundespräsident der Schweiz, Pascal Couchepin. In einem Aufsatz zum «Prix Evenir», den die Erdölvereinigung stiftet, schrieb Couchepin: «Es gibt keinen grundsätzlichen Widerspruch zwischen Wachstum und Umweltschutz. Nur ein Land mit entsprechenden Mitteln ist in der Lage, zukunftsweisende Projekte in der Umweltpolitik zu realisieren.»
Saubere Schweiz dank Vorschriften, nicht dank Wachstum
Das stimmt begrenzt in Bereichen, wo Umweltschutz mit der Entwicklung und dem Einsatz von Reinigungstechnik gleichgesetzt wird. Die reiche Schweiz zum Beispiel, die oft als «ökologisches Musterland» gepriesen wird, ist Pionier im Gewässerschutz. Als ab den 1960er-Jahren die steigende Phosphorbelastung die Seen im Alpenstaat in Kloaken zu verwandeln drohte, investierte der Staat in den folgenden Jahrzehnten zweistellige Milliardenbeträge für den Bau von mehrstufigen Abwasserreinigungs-Anlagen (ARA). Heute sind über 90 Prozent aller Schweizer Haushalte und Unternehmen an ARA angeschlossen, und die Phosphorbelastung in den Seen und Flüssen ist markant gesunken. Auf der anderen Seite stieg allerdings die Belastung der Gewässer durch neue chemische Verbindungen, die sich weniger gut aus dem Abwasser heraus filtern lassen, und durch die intensive Nutzung der Wasserkraft zur Stromerzeugung, was beides die Fischpopulation beeinträchtigt.
Frühe Erfolge verzeichnet die Schweiz auch bei der Bekämpfung der Luftverschmutzung: Die Konzentration von Schwefeldioxid in der Atemluft war hier schon immer kleiner als im übrigen Europa, weil es in der Schweiz nur wenig Schwerindustrie gibt (die entsprechenden Produkte werden importiert), und weil deshalb der Verbrauch von Kohle oder Schweröl mit hohem Schwefelgehalt gering blieb.
Zudem gibt es hier keine Autoindustrie mit entsprechend starker Lobby. Das erlaubte es der Landesregierung, ab 1986 als erstes Land in Europa strenge Abgasvorschriften im Alleingang zu verordnen, die den Einsatz von Katalysatoren erzwangen und damit den Ausstoss von Kohlenmonoxid, Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen deutlich reduzierten. Eine vorbildliche Luftreinhalteverordnung, welche die Behörden anfangs der 80er-Jahre unter dem Druck des Waldsterbens einführten, senkte die Schadstoff-Emissionen auch aus Heizungen und anderen stationären Anlagen.
Resultat: Die Verschmutzung der Luft mit giftigen Kohlenwasserstoffen, Kohlenmonoxid und Stickstoffdioxid ist in der Schweiz seit 1985 deutlich gesunken. Auch die meisten andern westeuropäischen Staaten haben – mit zeitlicher Verzögerung – ihre Giftfrachten in Abwässern und Abgasen reduziert.
Diese Teilerfolge im Umweltschutz sind aber nicht erreicht worden, weil die Wirtschaft wuchs, sondern weil der Staat strengere Abgas- und Abwasservorschriften erliess, welche die Entwicklung von Reinigungstechnik förderten.
Technische Lösungen stossen an Grenzen
Doch die «End of Pipe»-Technik, die sich wohlhabende Industriestaaten zum Selbstschutz leisten und dank florierender Wirtschaft auch besser leisten können als arme Entwicklungsländer, diese Technik hat Grenzen: Gegen den zunehmenden Abbau von Bodenschätzen wie Erdöl oder Eisenerz zum Beispiel hilft kein Katalysator. Keine Rauchgasreinigung verhindert, dass sich Kohlenstoff bei der Verbrennung in Kohlendioxid (CO2) umwandelt, in die Atmosphäre entweicht und das Treibhaus Erde aufheizt, oder dass Atomreaktoren wertvolles Uran in radioaktiv strahlenden Müll verwandeln, der die nächsten Generationen während Jahrtausenden belasten wird. Auch die Abholzung der Urwälder, die Versiegelung des endlichen Bodens und die Verschandelung der Landschaften durch Hoch- und Tiefbauten lässt sich mit Technik nicht verhindern. Hier wird die als Problemlöser gepriesene Wirtschaft zur Ursache des Problems, das sich mit weiterem Wirtschaftswachstum verschärft.
Zusammenhang von Wirtschaft und Ressourcenverbrauch
Global gibt es zwei einfache Regeln, die sich mit unzähligen Statistiken belegen lassen: Je höher der Umsatz einer Volkswirtschaft ist, desto höher ist tendenziell ihr Verbrauch an natürlichen Ressourcen. Und: Je mehr eine Volkswirtschaft wächst – immer gemessen am teuerungsbereinigten Bruttoinlandprodukt (reales BIP) –, desto stärker wächst der Bedarf von Primärenergie. Die wichtigsten Primärenergieträger sind Kohle, Erdöl, Erdgas, Uran, Holz und Wasserkraft.
Der Einsatz von Primärenergie, der sich statistisch relativ zuverlässig erfassen und vergleichen lässt, eignet sich als grober Indikator auch für den Verbrauch weiterer Naturgüter. Denn eng verbunden mit dem Energieeinsatz ist die Gewinnung und Verarbeitung von Metallen und Kunststoffen oder der Bau und Betrieb von Häusern und Verkehrsmitteln, die wiederum den Landverbrauch und das Landschaftsbild wesentlich beeinflussen.
Von der allgemeinen Tendenz, wonach der Stand der Wirtschaft und der Energiebedarf miteinander verkoppelt sind, gibt es allerdings einige Abweichungen: Bei gleichem Bruttoinlandprodukt verbrauchen zum Beispiel Staaten im hohen Norden mehr Heizenergie als südlicher gelegene Länder. Oder: Westeuropa, das die Energie stärker mit Steuern und Abgaben belastet, erzeugt die gleiche wirtschaftliche Wertschöpfung mit rund halb so viel Primärenergie wie die Billigenergie-Länder USA oder Australien, die besonders energieintensiv produzieren und konsumieren. Diese Unterschiede ändern aber nichts am allgemeinen Befund, wonach hohe wirtschaftliche Wertschöpfung mit hohem Naturverbrauch korrespondiert. So ist der Primärenergie-Verbrauch in armen Drittwelt-Ländern pro Kopf der Bevölkerung rund zehn Mal kleiner als in Nordamerika und rund fünfmal kleiner als in Westeuropa.
Bemerkenswert ist auch der Zusammenhang von Wirtschaft und Energieverbrauch, wenn man die zeitliche Entwicklung in einzelnen Staaten oder Ländergruppen betrachtet: Von 1990 bis 2000 wuchs das reale Bruttoinlandprodukt in allen Industriestaaten zusammen (OECD) um 128 Prozent, während der Primärenergie-Verbrauch im gleichen Zeitraum um 117 Prozent zunahm. Ähnlich verlief die Entwicklung in Österreich: Das reale BIP wuchs von 1990 bis 2000 um 25 Prozent, der Primärenergieverbrauch um 15 Prozent. Auch in Drittwelt-Ländern wie China und Indien ist das Wachstum der Wirtschaft verknüpft mit der Zunahme des Energiebedarfs.
Umgekehrt zog der wirtschaftliche Zusammenbruch in Russland Anfang der 90er-Jahre auch einen starken Rückgang des Energieverbrauchs nach sich. Eine Ausnahme von der Regel bildet Deutschland: Während hier die Wirtschaft von 1990 bis 2000 um 17 Prozent wuchs, schrumpfte der Primärenergieverbrauch im gleichen Zeitraum um 5 Prozent. Dieser Sonderfall rührt unter anderem daher, dass nach dem Zusammenschluss von Ost- und Westdeutschland viele besonders ineffiziente Kraftwerke und Produktionsanlagen im Osten stillgelegt oder saniert wurden.
Entkoppelung oder die Hoffnung auf immaterielles Wachstum
Immerhin, so zeigt der Vergleich, wuchs der Verbrauch von Primärenergie in den meisten westlichen Industriestaaten in den letzten zehn bis zwanzig Jahren weniger stark als das Bruttoinlandprodukt (aber immer noch stärker als die Bevölkerungszahl). Die Energieintensität in den Industriestaaten hat also etwas abgenommen. In einer Broschüre über «Weltbevölkerung, Umwelt und Energie» lieferte der Erdölmulti Shell dafür schon 1989 eine einleuchtende Erklärung: «Ursachen für den sinkenden Energiebedarf (gemeint ist der sinkende Energiebedarf pro Einheit BIP) der OECD-Staaten sind der Wandel zu einer weniger energieintensiven, postindustriellen Dienstleistungsgesellschaft, eine effizientere Energienutzung und nicht zuletzt die Energiesparmassnahmen, die als Reaktion auf die Ölpreisschocks früherer Jahre und auf das wachsende Umweltbewusstsein erfolgten.»
Schöne Worte vom qualitativen oder nachhaltigen Wachstum
Solche Worte nährten die Hoffnung, der Energiebedarf werde sich weiter vom Wirtschaftswachstum entkoppeln, also künftig Wirtschaftswachstum bei sinkendem Energie- und Materialverbrauch ermöglichen. Diese Entwicklung beschwören Ökonomen und Politiker seit vielen Jahren unter den Schlagworten «qualitatives» oder «nachhaltiges Wachstum».
Schon in den 1970er-Jahren schrieb zum Beispiel die Kommission, die den Auftrag erhielt, für die Schweiz eine Gesamtenergiekonzeption (GEK) zu erarbeiten, in ihrem Schlussbericht: «Das Wirtschaftswachstum muss in Zukunft mit weniger Energiewachstum erreicht werden.» Die gleiche Botschaft wiederholte 1992 der Industrielle Stefan Schmidheiny in seinem Buch «Kurswechsel», das er zusammen mit anderen global tätigen Wirtschaftsführern vor dem Erdgipfel in Rio verfasste. Damit wollte er «weiteres Wachstum mit einer effizienteren Nutzung von Energie und Rohstoffen» verknüpfen. Nochmals drei Jahre später konkretisierten Ernst Ulrich von Weizsäcker, Amory und Huntert Lovins diesen «Kurswechsel» im Buch mit dem Titel «Faktor vier». Demnach soll die Produktivität aus der Nutzung von natürlichen Ressourcen wie Energie, Boden oder Stoffen um das Vierfache gesteigert werden. Um die Interessenvertreter von Wirtschaft und Natur gleichermassen zufrieden zu stellen, teilten die Autoren diesen Effizienzgewinn salomonisch nach der Formel «Doppelter Wohlstand, halbierter Naturverbrauch».
Wirtschaftswissenschafter, die sich mehr mit ökonomischen Theorien denn mit Umweltstatistiken beschäftigen, erklären uns, die grosse Effizienzrevolution sei bereits im Gang. Zu ihnen gehört Thomas Straubhaar, Ökonomieprofessor und Präsident des Weltwirtschaftsarchivs in Hamburg. Im März 2004 sagte der gebürtige Schweizer in einem Interview mit dem Zürcher «Tages-Anzeiger» folgendes: «Ökonomisches Wachstum kann ressourcenschonend sein. Das war es in den letzten vierzig Jahren zunehmend. Wie viel Material steckt noch in einem Fernseher verglichen mit vor dreissig Jahren. Mit wie wenig Benzin lassen sich heute Autos betreiben verglichen mit früher. Wie klein sind heute viele Apparate geworden. Wachstum kann dazu dienen, die Umweltbelastung zu reduzieren.»
Aus diesen positiv gefärbten Beobachtungen folgert Straubhaar: «Die Wirtschaft kann ewig wachsen», denn: «Wirtschaftswachstum kann virtuell und muss nicht physisch sein. Was wächst, sind Buchungsgrössen, Bewertungen. Eine Dienstleistung, wie Bildung beispielsweise, findet in den Köpfen der Menschen statt. Wir belasten die Umwelt nicht, wenn wir uns mit der Relativitätstheorie befassen.»
Die Wirklichkeit ist anders: Das Beispiel Schweiz
Die Wirklichkeit aber widerlegt die schöne Theorie. Das gilt speziell für die Schweiz, einem Land, wo der Übergang von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft schon früher begonnen hat als in andern OECD-Staaten und besonders weit gediehen ist. Hier wuchs der Verbrauch von nicht erneuerbarer Energie und nicht vermehrbarem Boden in den letzten zwanzig Jahren sogar noch stärker als die Wirtschaft. Das Gleiche gilt auch für den Zuwachs von Wohnraum und Autobestand.
Das belegen folgende Daten der nationalen Statistik, zunächst über die Entwicklung in den 1990er-Jahren:
- Das teuerungsbereinigte Bruttoinlandprodukt, also das Mass für die Wertschöpfung der inländischen Wirtschaft, stieg in der Schweiz von 1990 bis 2000 um 11 Prozent.
- Der Primärenergieverbrauch wuchs klimabereinigt (also korrigiert aufgrund der jährlich schwankenden Zahl von Heizgradtagen) im gleichen Zeitraum ebenfalls um 11 Prozent. Die Energieintensität pro Einheit BIP blieb somit gleich hoch. Etwas weniger stark wuchs der Ausstoss des Klimagases CO2, weil innerhalb des Primärenergieverbrauchs eine Verlagerung vom Erdöl zum Erdgas und zu Atombrennstoffen stattfand.
- Die Energienutzungsfläche, also die beheizten oder gekühlten Geschossflächen der Gebäude, nahm um 18 Prozent zu. Der Raumbedarf für Wohnungen, Industrie-, Gewerbe- und Bürobauten wuchs seit 1990 also noch stärker als die Wirtschaft und der Energiebedarf und zersiedelte die kleinräumige Landschaft zusätzlich.
- Der Bestand an Autos – eines der material- und energieintensivsten Güter – stieg um 19 Prozent und übertraf damit den Zuwachs des realen Bruttoinlandproduktes ebenfalls deutlich. Etwas weniger stark als die Zahl der Fahrzeuge nahm hingegen die Fahrleistung (in Fahrzeugkilometern) und die Transportleistung (in Personenkilometern) zu, weil die Fahrleistung und der durchschnittliche Besetzungsgrad gesunken sind. Was zeigt: Eine wachsende Zahl an Autos senkt die Transporteffizienz.
- Bauten und Autos zusammen sowie die in den Gebäuden benutzten Haushalt- und Bürogeräte verbrauchen in der Schweiz mehr als die Hälfte aller Energie. Gebäude und Motorfahrzeuge benötigen aber auch viel Material wie Beton, Backsteine, Holz, Eisen, Aluminium, Kunststoffe usw. Damit dürfte auch der – statistisch schwerer erfassbare – Stoffverbrauch in der Schweiz entsprechend gestiegen sein. Diese Vermutung wird erhärtet durch die Abfallstatistik: Die Menge an Siedlungsmüll wuchs in den 90er-Jahren um 11 Prozent und damit gleich stark wie die Wirtschaft. Immerhin hat der Anteil an separat gesammelten und rezyklierten Zeitungen, Flaschen, Aluminium-Dosen und Pet-Flaschen in den letzten Jahren weiter zugenommen.
Nun gibt es Leute, die sagen, die Effizienz des Energie- und übrigen Naturverbrauchs habe sich nur deshalb nicht verbessert, weil die Schweizer Wirtschaft in den 1990er-Jahren weniger stark gewachsen sei als in früheren Jahren. Doch die Statistiken widerlegen auch diese Behauptung:
In den boomenden 1980er-Jahren wuchsen Gebäudeflächen (plus 24 Prozent), Autobestand (plus 33 Prozent) und klimabereinigter Energieverbrauch (plus 24 Prozent) ebenfalls stärker als das reale BIP (plus 23 Prozent). Der gleiche Trend ist seit den 50er-Jahren zu beobachten.
Ineffizienter Konsum: Mengenzuwachs vernichtet Produktivitätsgewinn
Es trifft zwar zu, dass die Wirtschaft ihre Ressourcenproduktivität stetig steigert. Das gilt in erster Linie in der Produktion: Staaten mit einem hohen Anteil an Schwerindustrie und anderen energieintensiven Branchen, zum Beispiel Deutschland, konnten ihre Energieeffizienz in den letzten Jahren deutlich erhöhen. In der Schweiz hingegen bewegte sich der Anteil der Industrie am gesamten Energieverbrauch schon immer weit unter dem europäischen Durchschnitt, weil das Land der Banken und Versicherungen einen wesentlichen Teil der material- und energieintensiven Rohstoffe, Halbfabrikate und Produkte importiert.
Diese in den Produkten enthaltene graue Energie wird von der inländischen Energiestatistik nicht erfasst. Deshalb wirkt sich die Steigerung der Energieeffizienz in der industriellen Produktion der Schweiz weniger stark auf den Gesamtenergieverbrauch aus als in anderen Staaten. Viel stärker fällt hier der Energie- und Materialeinsatz im Bereich Konsum ins Gewicht, insbesondere für Wohnen und Verkehr.
Die Energieeffizienz von Bauten, Geräten und Automotoren ist zwar ebenfalls gestiegen, aber weit weniger stark, als es der Stand der Technik erlauben würde. So zeigt eine Untersuchung des Bundesamtes für Energie, dass die Häuser, die in den 1990er-Jahren in der Schweiz gebaut wurden und während Jahrzehnten die Energiebilanz belasten, rund zweieinhalbmal so viel Energie verbrauchen, wie Minergie-Bauten, die seit 1990 dem Stand der Bautechnik entsprechen.
Die Menge schlägt die Effizienzsteigerungen
Die Hauptursache für den wachsenden Naturverbrauch aber besteht darin, dass die Zunahme der Menge an Gütern und Dienstleistungen die Steigerung der Energieeffizienz oder der Fortschritte im Recycling ausgleicht und in einigen Bereichen sogar überkompensiert. So steht der zunehmenden Effizienz in der Produktion eine wachsende Ineffizienz des Konsums gegenüber. Zur Illustration zwei Beispiele:
- Beispiel Auto: In den 1960er-Jahren wog ein Volkswagen rund 700 Kilogramm und transportierte in der Schweiz – weil damals noch weniger Leute ein eigenes Auto besassen – im Durchschnitt 2,4 Personen mit einem Durchschnittsgewicht von schätzungsweise 70 Kilo. Das Verhältnis zwischen dem Gewicht der zu transportierenden Personen (168 Kilo) und dem Eigengewicht des Transportmittels (Tara) betrug also 1 zu 4. Heute wiegt ein neu zugelassenes Durchschnitts-Auto in der Schweiz 1700 Kilo und der durchschnittliche Besetzungsgrad ist auf 1,5 Personen (105 Kilo) gesunken. Das Verhältnis Transportgut zur Tara verschlechterte sich damit auf 1 zu 16. Salopp ausgedrückt: Doppelt so viel Blech für halb soviel Fleischtransport – auch das ergibt einen Faktor 4, allerdings in die falsche Richtung. Weil die Energieeffizienz der Motoren in dieser Zeit nicht in gleichem Mass zugenommen hat, braucht der Mensch heute für die gleiche Transportleistung nicht weniger, sondern mehr Energie.
- Beispiel Wohnraumnutzung: Von 1980 bis 2000 wuchs das reale Bruttoinlandprodukt in der Schweiz um 36 Prozent. Die Fläche der Zweitwohnungen nahm im gleichen Zeitraum um 101 Prozent zu, hat sich also innerhalb von nur zwei Jahrzehnten verdoppelt. Bei Zweitwohnungen, die im Durchschnitt über 300 Tage pro Jahr leer stehen, handelt es sich um ein besonders ineffizient genutztes Produkt, das gleichzeitig viel (Bau-)Material, Energie und Raum im speziell empfindlichen Alpenraum beansprucht. Gemessen an der gesamten Wohnfläche, die zwischen 1980 und 2000 in der Schweiz entstanden ist, entfiel nicht weniger als ein Fünftel auf Zweitwohnungen. Der Boom dieser beheizten Kapitalanlagen, die sich in der Regel nur überdurchschnittlich wohlhabende Leute leisten können, ist auch auf die ungleiche Verteilung des Vermögenszuwachses zurückzuführen.
Die Beschäftigung mit der Relativitätstheorie kann die wachsende Kaufkraft nicht abschöpfen
Die Beispiele und Statistiken belegen: Die immaterielle, «nicht physisch» konsumierende Gesellschaft, die Thomas Straubhaar und andere Ökonomen herbeireden, ist nicht entstanden. Die Beschäftigung mit der Relativitätstheorie mag die wachsende Kaufkraft nicht abzuschöpfen. Angeregt durch Werbung und angetrieben durch Status- und Prestigedenken kaufen Konsumentinnen und Konsumenten weiterhin material- und energieintensive Güter – Güter im Übrigen, deren Preis verfälscht ist, weil die Menschheit die natürlichen Ressourcen nahezu zum Nulltarif ausbeutet. Auch Dienste, die in der postindustriellen Gesellschaft mit einem wachsenden Anteil am Bruttoinlandprodukt partizipieren, können sehr energie- oder materialintensiv sein. Denn Dienstleistungen bestehen nicht allein aus Bildung oder Kultur. Der Tourismus, der uns viele schlecht ausgenutzte Bauten und Anlagen beschert, oder energieintensive Flugreisen, die überdurchschnittliche Wachstumsraten verzeichnen, gehören ebenso zum Sektor Dienstleistungen.
«Der ungezügelte Konsum», der das Wachstum der Wirtschaft antreibt, «verschlingt enorme Ressourcen, von denen viele weit über das erneuerbare Mass in Anspruch genommen werden», schreibt Christopher Flavin, Präsident des Worldwatch-Instituts, im «Bericht zur Lage der Welt 2004», der sich speziell den ökologischen Auswirkungen der Konsumgesellschaft widmet. Zu befürchten ist deshalb, dass die Ausbreitung der westlichen Konsummuster den Ressourcenverbrauch auch in jenen Staaten massiv steigern wird, die den Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft und von der Industrie- zur postindustriellen Gesellschaft noch vor sich haben.
_____________________________________
QUELLEN:
– OECD-Statistiken
– BP-Statistical Review of World Energy
– Shell Briefing Service, June 1989.
– Bundesamt für Statistik, Bern – Bundesamt für Energie, Bern
– Bundesamt für Umwelt, Bern
– Tages-Anzeiger, Zürich, 6.3.2004.
– Stephan Schmidheiny: Kurswechsel, Zürich, 1992.
– Ernst Ulrich von Weizsäcker u.a. Faktor vier, München 1995.
– Worldwatch Institute: State of the World, Washington, 2004
– Gasche/Guggenbühl/Vontobel: Das Geschwätz von der freien Marktwirtschaft, Ueberreuter, Wien 1997
– Gasche/Guggenbühl: «Das Geschwätz vom Wachstum», Orell Füssli, Zürich 2004.
– Eigene Berechnungen des Verfassers.
Vom «Geschwätz vom Wachstum» zum «Wachstumswahn»
Zusammen mit Urs P. Gasche schrieb Hanspeter Guggenbühl im Jahr 2004 das Buch ‹Das Geschwätz vom Wachstum›, Orell Füssli Verlag Zürich, das in der Schweiz während mehreren Wochen in der Bestseller-Liste der zehn meistverkauften Sachbücher figurierte und intensive Diskussionen auslöste. Aus dem Verlagstext: «Die beiden Autoren zeigen, dass Wirtschaftswachstum die Probleme nicht löst, die es vorgibt zu lösen: Wirtschaftswachstum beseitigt weder Armut noch Arbeitslosigkeit, ist für die Finanzierung der Renten nicht nötig, verschlechtert unsere Lebensqualität und zerstört die Natur. ‹Darum›, so schreiben die Autoren, ‹ist es ein Gebot der Vernunft, uns schrittweise vom Wachstumszwang zu befreien und alternative Lösungen endlich ernsthaft zu diskutieren›.»

Im Jahr 2010 aktualisierten die Autoren ihre Wachstumskritik im Buch «Schluss mit dem Wachstumswahn – Plädoyer für eine Umkehr». Somedia-Buchverlag, 2010. Aus der Verlagsankündigung: «Die Verschwendung muss ein Ende finden. Lebensqualität muss Vorrang haben gegenüber dem Wachstum von Konsum und Bevölkerung. Die Grössten, also die reichen Industriestaaten müssen ihr Wachstum als erste beenden. Dafür plädiert dieses Buch. Und es zeigt Auswege aus der Wachstums- und Verschuldungsfalle.»
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.
in memoriam hpg: Serie im Gedenken an Hanspeter Guggenbühl

Hanspeter Guggenbühl (2. Februar 1949 – 26. Mai 2021) gehörte zu den profiliertesten Schweizer Journalisten und Buchautoren für die Themen Energie, Umwelt, Klima und Verkehr. Hanspeter Guggenbühl engagierte sich seit den Gründerjahren mit viel Leidenschaft für Infosperber – er schrieb mehr als 600 Artikel und prägte die Online-Zeitung ganz wesentlich. Sein unerwarteter Tod ist ein grosser Verlust für den Journalismus, für Infosperber und für alle, die ihm nahestanden.
Um einen Beitrag an das Andenken von Hanspeter Guggenbühl zu leisten, haben sich mehrere Schweizer Autor:innen bereit erklärt, einen Text mit der Vorgabe zu schreiben, dass Hanspeter ihn gerne gelesen hätte. «Gerne gelesen» heisst nicht, dass er nicht widersprochen hätte – war ihm die argumentative Auseinandersetzung doch ebenso wichtig wie das Schreiben. Alle Beiträge werden als Serie «in memoriam hpg» zusammengefasst und im hier verlinkten Dossier vereint.
Diese Woche ergänzen wir die Serie «in memoriam hpg» mit einem der vielen Artikel von Hanspeter Guggenbühl, die auch noch nach Jahren von ihrer Aktualität nichts verloren haben.





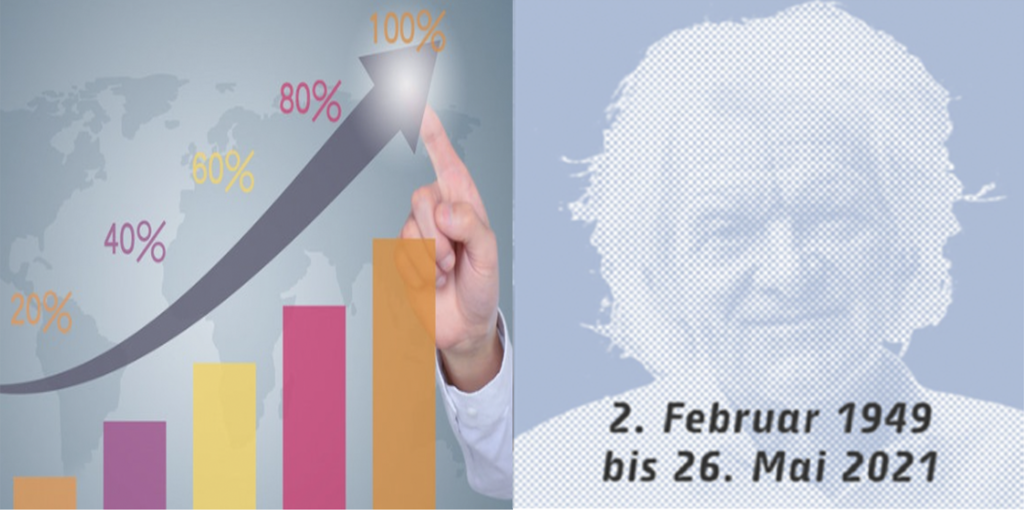





«Wie viel Material steckt noch in einem Fernseher verglichen mit vor dreissig Jahren»
Das stimmt zwar, es ist wesentlich weniger, allerdings muss man die Gebrauchsdauer mit berücksichtigen. Damals hatte man Fernseher so zwischen 10 bis gar 20 Jahre in Betrieb.
Die Nutzungszyklen wurden dann aber immer kürzer weil die Geräte sehr schnell veraltet waren.
Auch die Reparierbarkeit hatte stark nachgelesen. Zudem ist man durch die niedrigen Preise schnell dazu geneigt, wieder etwas Neues anzuschaffen.
Und jedes neue Windows war wieder ressourcenhungriger als das letzte. So mussten PC’s millionenweise nach wenigen Jahren wieder durch leistungsstärkere Modelle ersetzt werden.
Leider glauben auch heute die meisten Ökonomen immer noch, der Planet müsse sich gefälligst ihrer Ökonomie aus stets steigenden, nackten Zahlen anpassen. Wir leben in einem Zahlengefängnis. Welche Macht zwingt uns eigentlich dazu? Die Tierwelt kommt ohne Geld und Zahlen aus und funktioniert trotzdem. Sollten wir uns da nicht etwas abschauen statt in erstarrten, fixen ökonomischen Zuständen zu verharren?
Das Wirtschaftswundermotto «Wachstum auf Kosten von immer noch mehr Wachstum» hat sich zwar in Tat und Wahrheit schon längst tot gelaufen, bestimmt aber – inzwischen grün kaschiert und technologisch optimiert – nach wie vor das Denken und das Handeln: immer noch mehr bis zum Gehr-nicht-mehr. Viele werden es nicht überleben!
Von nichts kommt nichts. Wenn ich ein Produkt oder Energie erzeugen will, muss ich Ausgangsstoffe haben, die ich der Erde, dem Wasser oder der Luft entnehme. Wachstum mag zwar für das Kapital gut sein, aber nicht fürs Klima. Wenn ich das Klima schützen will, muss ich das Wachstum reduzieren. Es gibt kein «grünes» oder «nachhaltiges» oder «klimafreundliches» Wachstum. Das ist genauso unsinnig wie die Ablassscheine im Mittelalter und ein reiner Euphemismus. Klimaschutz und Wachstum stehen sich antagonistisch gegenüber und schließen sich gegenseitig aus. So sind E-Autos und ihre Batterien niemals emissionsfrei. Sie hinterlassen bei ihrer Herstellung einen großen ökologischen Fußabdruck, bevor sie überhaupt auf die Straße kommen. Betrieben werden sie mit Strom, der zum größten Teil eben nicht «grün» ist. Im Betrieb entsteht durch Reifen- und Bremsenabrieb Feinstaub. Und entsorgt werden müssen sie auch einmal. Deswegen lügen führende Automobilmanager und auch Politiker, wenn sie behaupten, die E-Automobilität wäre der richtige Schritt in die Zukunft. Echter Klimaschutz kann m.E. nur mit Verzicht erreicht werden, nämlich indem wir unseren teilweise perversen Konsum reduzieren und nicht alles kaufen, was uns die Werbeindustrie mit riesigem Aufwand präsentiert. Allerdings befürchte ich, dass sich die menschliche Bereitschaft zum Verzicht bzw. für eine ressourcenschonende Lebensweise in engen Grenzen hält.
Bin mit Ihnen einverstanden, Herr Schiebert. Möchte ergänzen: Kriege, selbst wenn sie im Namen eines Gottes geführt werden, sind ein Teufelswerk. Krieg ist eine extrem gierig-rücksichtslose-verbrecherisch-zerstörerische Form des geilen Allerwelts-Prinzips «Konkurrenz belebt das Geschäft … und mit Verlusten muss gerechnet werden!». Ein Denk- und Handlungsmodell, das – auch wenn in einer weniger brutalen Art als ein Krieg mit Waffen – in sämtlichen Lebensbereichen anzutreffen ist. Konkurrenz macht die Herzen kalt und die Köpfe heiss. Von Menschen, die nicht geerdet sind und mit ihren Händen ihre Welt zerstören. Frieden schaffen ohne Waffen … und auf Konkurrenz verzichten!