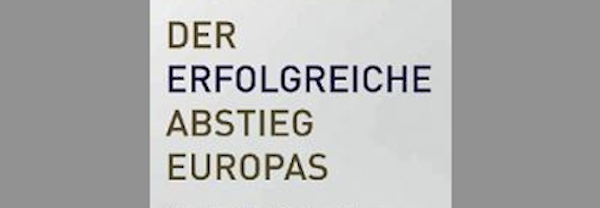«Europa muss vom hohen Ross herunter»
(Red.) «Die Gipfelträume sind ausgeträumt…Der Westen ist nicht mehr die unbestrittene Nummer eins in der Weltpolitik», sagt Professor Eberhard Sandschneider, Inhaber des Lehrstuhls für die Politik Chinas und Internationale Beziehungen an der Freien Universität Berlin.
Schwellenländer wie Indien, Brasilien und vor allem China würden ökonomisch und perspektivisch auch politisch immer schneller aufsteigen, während Europa und die USA sich von einer Krise in die nächste schleppten.
Zumindest Europa befinde sich in einem relativen Abstieg. «Wir reden bei diesen Fragen nicht mehr über drohende Zukunftsszenarien», meint Sandschneider, «sondern über die Realität internationaler Politik in der Gegenwart.»
Die unabhängige Informations-Plattform «german-foreign-policy.com» hat Sandschneider interviewt.
—-
INTERVIEW
Frage: Sie plädieren dafür, den weltpolitischen Abstieg Europas nicht zu verhindern, sondern ihn erfolgreich zu gestalten. Wieso?
Professor Eberhard Sandschneider: Weil es dazu keine Alternative gibt. Auf- und Abstiege sind völlig normale Prozesse, und wir beobachten im Moment – auch bedingt durch den Aufstieg von Schwellenländern – einen relativen Abstieg Europas, wenn Sie so wollen, auch einen Abstieg des Westens. Fehler passieren in der internationalen Politik in solchen Abstiegsprozessen häufig, und sie können dann auch gnadenlos in die Katastrophe führen. Nehmen Sie zum Beispiel die Fehler, die Grossbritannien und Frankreich begingen, als Deutschland aufstieg. Nehmen Sie aber auch das sehr erfolgreiche Management des eigenen Abstiegs durch Grossbritannien, als die USA aufstiegen. Die Fragen, die damit in Zusammenhang standen, können sie eigentlich direkt übersetzen auf die Frage des heutigen Umgangs mit China, Brasilien oder Indien: Wie gehen wir so mit deren Aufstieg um, dass daraus keine politischen Konfrontationen, keine Katastrophen entstehen? Konfrontationen werden beispielsweise in der US-amerikanischen China-Politik schon ganz offensiv angedacht.
Was droht da konkret?
Es gibt einen markanten Unterschied in der China-Politik der Vereinigten Staaten und Europas. Europa diskutiert China als Wirtschaftsfaktor, als Markt, als Wettbewerber, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch als Rivalen. Das hat aber keine sicherheitspolitische bzw. militärische Dimension. In den Vereinigten Staaten gibt es diese Dimension aber. Das Pentagon schreibt mittlerweile Positions- und Strategiepapiere, in denen ganz glasklar festgehalten wird: Eine der künftigen zentralen militärischen Herausforderungen für die Vereinigten Staaten wird China sein.
Militärisch?
Militärisch. Da wird der internationale Terrorismus als erste militärische Herausforderung genannt, als zweite direkt China. In dieser Deutlichkeit. Es gibt unmittelbare militärische Berührungspunkte, in der Taiwan-Frage zum Beispiel, indirekt vielleicht auch in der Nordkorea-Frage oder beim Verhalten Chinas im Südchinesischen Meer. All das sind Themen, die für uns Europäer weit, weit entfernt sind, obwohl sie uns im Ernstfall natürlich wirtschaftlich und auch politisch genauso berühren würden wie die USA. Wenn hier in Europa jedoch über China diskutiert wird, haben wir es vor allem mit wirtschaftlichen Fragen zu tun, mit dem berühmten Technologie-Diebstahl etwa, oder mit den besonders hehren Fragen einer Wertepolitik etwa im Falle des Dalai Lama…
…die Sie sehr kritisch sehen…
… Sehr sogar. Bitte: Nichts gegen unsere Werte und nichts dagegen, dass wir stolz auf sie sein können. Aber wer glaubt, unsere Werte in anderen Teilen der Welt auf eine Weise verbreiten zu müssen, wie das Teile unserer politischen Elite und auch einige NGOs tun – und dabei permanent in die Glaubwürdigkeitsfalle von doppelten Standards tappen -, der darf sich nicht wundern, wenn diese Werte irgendwann Schaden nehmen. Seien wir doch offen: Wenn jemand etwas hat, was wir wirklich brauchen – geostrategisch, rohstoffwirtschaftlich -, dann vergessen wir plötzlich die Wertefragen. In Ägypten etwa übersehen wir komplett, dass die Militärregierung dort auf das Harscheste gegen Regimekritiker vorgeht, mittlerweile weit über 10.000 Menschen verhaftet und abgeurteilt hat. Da fehlt mir die warnende Stimme Europas. Das ist mein eigentlicher Kritikpunkt: Die Glaubwürdigkeit westlicher Wertepolitik ist in Asien, in Lateinamerika und in grossen Teilen Afrikas schlicht dahin. Das ist nicht nur das Ergebnis von acht Jahren Bush-Politik, sondern auch das Ergebnis der europäischen Doppelbödigkeit.
Sie warnen in Ihrem Buch auch davor, Demokratie mit Gewalt zu «exportieren», weil die Demokratie in den betreffenden Gesellschaften von innen wachsen muss.
Das ist, meine ich, die historische Lehre, die man aus der Transformationsdebatte der letzten 20 Jahre ziehen kann. Wenn man glaubt, sozusagen an der Speerspitze von Streitkräften die Demokratie exportieren zu können, dann muss man auch hinschauen, wie die Bilanz nach zehn oder 20 Jahren aussieht. Ich sehe keine Demokratie in Afghanistan, ich sehe keine im Irak, und ich wage die Prognose: Es wird jetzt auch in Libyen keinen Übergang zur Demokratie geben. Überall dort, wo der Westen sich militärisch engagiert hat, sind wir weit davon entfernt, auch nur halbwegs funktionierende demokratische Strukturen vorzufinden. Da wird’s dann doch irgendwann mal Zeit, ein Fragezeichen zu setzen.
Auch angesichts der Tatsache, dass der Westen ja genügend Diktaturen unterstützt, wenn sie aussenpolitisch kooperieren…
Das kommt noch hinzu. Die Aussenpolitik nicht nur Deutschlands, sondern westlicher Staaten insgesamt hat genau hier ihre Schwachstelle. Ich bin vergangene Woche in eine Diskussion mit einem offiziellen iranischen Regierungsvertreter geraten, der genau diesen Punkt – ausgerechnet aus der Sicht des Iran – festhielt und ganz scheinheilig und durchaus spitz fragte: Sie kritisieren Menschenrechtsverletzungen im Iran; aber wie ist es eigentlich mit Ihrem strategischen Partner Saudi-Arabien und der Anwendung der Scharia dort? Dazu sagen Sie komischerweise nichts. Warum eigentlich nicht? – Wenn Sie sich in einer solchen Diskussion befinden, merken Sie, wie leicht von ausserhalb Europas diese Politik zu durchschauen ist. Und wenn sich das dann noch verbindet mit wachsender finanz- und wirtschaftspolitischer Abhängigkeit wie jetzt in der Euro-Krise, dann wird’s schlimm – weil andere, nicht-westliche Staaten ziemlich genau wissen, wie sie uns aushebeln können, wenn sie sich attackiert fühlen.
Ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel. Ich habe in meinem Buch die Prognose gewagt, Frau Lagarde werde vorerst die letzte Europäerin an der Spitze des IWF sein. Gerade in diesen Tagen spielen die Chinesen ganz offen mit dem Gedanken, ihre Unterstützung für den Euro vielleicht gar nicht direkt, sondern über den IWF abzuwickeln, im Gegenzug natürlich aber auch grössere Stimmrechte im IWF zu verlangen. Da bereitet sich eine grosse Volkswirtschaft darauf vor, die nächste IWF-Spitze schon frühzeitig bestens organisiert zu haben, während die Europäer noch glauben, das sei eine Bank für sie.
Sie schreiben, es gehe «bei aller gebotenen Bescheidenheit» gegenüber dem Ausland in Sachen Demokratie auch «darum, eben diese Errungenschaften nicht aus den Augen zu verlieren, wenn man über die Herausforderungen der Zukunft nachdenkt». Letztes Jahr hat Herfried Münkler in der Internationalen Politik berichtet, es werde auch hierzulande über Demokratie diskutiert und darüber, ob sie den Anforderungen der Gegenwart in ihrer heutigen Form noch gerecht werde. Was sagen Sie dazu?
Ich stelle diese Frage sehr verhalten auch und stelle fest: Wir kommen allmählich hier in Deutschland in eine Demokratiedebatte, die mit vielen Dingen zu tun hat. Sie hat natürlich auch mit dem Aufstieg von Autokratien zu tun, aber da sage ich: Vorsicht – die müssen erst mal beweisen, dass sie auf Dauer in der Lage sind, stabile politische Strukturen zu schaffen. Da sind Autokratien in der Regel eher schlechter aufgestellt als Demokratien. Aber wir haben natürlich das Problem, dass auch demokratisch bestens legitimierte Entscheidungen falsch sein können. Es geht darum, auch in Demokratien effiziente Problemlösungen hervorzubringen. Wenn Demokratien auf Dauer unfähig sind, das zu tun, dann geraten sie unter Druck. Das ist eine Lehre aus der vergleichenden Demokratieforschung; Lateinamerika ist voll von Beispielen, die Weimarer Republik ist ein weiteres. Als Beispiel für eine gescheiterte Transformation zur Demokratie drängt sich Russland geradezu auf. Auch Demokratien können scheitern. Wir wären sicherlich gut beraten, nicht nur anderen den Spiegel vorzuhalten, sondern ihn auch einmal umzudrehen und selbst hineinzuschauen.
—-
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Professor Eberhard Sandschneider ist Inhaber des Lehrstuhls für Politik Chinas und Internationale Beziehungen an der Freien Universität Berlin. Er hat unlängst das Buch «Der erfolgreiche Abstieg Europas» publiziert. Die Informationen auf Foreign-policy.com werden von einer Gruppe unabhängiger Publizisten und Wissenschaftler zusammengestellt, die das Wiedererstarken deutscher Grossmachtbestrebungen auf wirtschaftlichem, politischem und militärischem Gebiet kontinuierlich beobachten. german-foreign-policy.com bezieht weder direkt noch indirekt öffentliche Mittel und versteht sich als ein staatsfernes Medium.