Mittel- und Südamerika: Eine Region im Umbruch
Nach dem Wahlsieg des Ultraliberalen Milei vor einem Jahr in Argentinien wittern die Konservativen – nicht nur in diesem Land – Morgenluft. Die Linke sieht sich hingegen in einem Wechselbad der Gefühle: Einerseits die Bestätigung, dass die Demokratie im kleinen Uruguay weiterhin reibungslos funktioniert, auch weil die Stimmberechtigten wiederum eine Koalition ans Ruder brachten, die von Sozialisten angeführt wird. Andererseits bedenkliche Zerfallserscheinungen bei der ähnlich orientierten Regierungspartei in Bolivien. Und noch bitterer das Abdriften in Richtung einer linksautoritären Herrschaft in Venezuela und Nicaragua.

In Argentinien will Javier Milei mit seinem radikalen Sparkurs das Land aus der tiefen Krise führen. In seinem ersten Amtsjahr kürzte er nicht nur den argentinischen Sozialstaat zusammen, sondern er setzte bei fast jeder staatlichen Ausgabe den Rotstift an und liess rund ein Zehntel der öffentlichen Stellen streichen. Während die bürgerlich-konservativen Medien Milei bereits als Sieger in einem heroischen Kampf gegen «sozialistische» Umverteilung des Reichtums und für einen drastischen Abbau «unnötiger» staatlicher Strukturen feiert, zeigt der «Tagesanzeiger» diverse Schwachstellen in Mileis Rosskur auf.
Zwar erzielt der argentinische Staat nun seit mehreren Monaten wieder positive Haushaltszahlen. Doch gleichzeitig verzeichnet Argentinien im ersten Halbjahr die höchste Armutsquote seit 20 Jahren (53 Prozent). Ohne Rücksicht auf die Opfer (die in die Millionen gehen), prahlt der Präsident mit Zahlen und Bilanzen des öffentlichen Haushalts, die den Erfolg seiner Politik dokumentieren sollen. Doch allein die Tatsache, dass die Inflation im gesamten ersten Jahr seiner Präsidentschaft immer noch im dreistelligen Bereich liegt, dürfte ein Beleg seines Scheiterns sein. Wer mit schwerem Geschütz auffährt – der berüchtigten Kettensäge –, darf nicht viel Zeit verlieren mit Experimentieren. Denn die Geduld der Opfer ist begrenzt, wie die Geschichte Lateinamerikas und ganz besonders Argentiniens zeigt.
Das Abflauen der Inflation im vergangenen Jahr von rund 300 auf etwa 100 Prozent hat die Bresche zwischen dem offiziellen Dollarkurs und dem Schwarzmarkt-Kurs praktisch verschwinden lassen. Das bedeutet jedoch, dass heute alle Güter und Dienstleistungen im Mittel doppelt so viel kosten wie vor einem Jahr. In vielen Fällen hat sogar eine Multiplikation der Preise stattgefunden. Damit ist Argentinien 2024 schlagartig von einem der billigsten Länder des Subkontinents zu einem der teuersten geworden. Weil jedoch gleichzeitig der Devisenhandel eingefroren wurde, konnte die – zwar sinkende, im ganzen Jahr aber immer noch viel zu hohe – Inflation nicht durch eine entsprechende Abwertung des Pesos kompensiert werden.
Die daraus resultierende Überbewertung der Landeswährung ist das schlimmste Gift für die Wirtschaft: Sie erschwert die Exporte, erleichtert im gleichen Zug die Importe und fördert Reisen wohlhabender Argentinier ins Ausland. Das dramatische Ende ist leicht absehbar: akuter Devisenmangel, Unternehmens- und Bankenpleiten, Heerscharen von Arbeitslosen, soziale Dramen und oft auch Gewaltausbrüche. Alles schon dagewesen: In Zeiten der berüchtigten Junta (1976-83), des bürgerlich Radikalen Raúl Alfonsín mit seinem «Plan Austral» (1983-89), unter dessen Nachfolger, dem zum Liberalismus bekehrten Peronisten Carlos Menem und zuletzt unter dem Konservativen Mauricio Macri. Alle scheiterten zum Schluss kläglich an der notorischen Überbewertung der eigenen Währung.
Seit Monaten bettelt Milei beim Internationalen Währungsfonds um einen Notkredit. Die Antwort aus Washington ist stets dieselbe: Zuerst müsse Buenos Aires die Kontrolle des Devisenhandels lockern, denn ohne diese Massnahme könne man nicht garantieren, dass das Fremdkapital im gewünschten Ausmass nach Argentinien fliesse. Mit diesem Diktat hatte der IWF vor sieben Jahren den damaligen Präsidenten Mauricio Macri zur Liberalisierung der Kapitalströme gezwungen. Dieser öffnete die Schleusen mit dem Resultat, dass der grösste Teil des Rekordkredits in Höhe von über 50 Milliarden US-Dollar für Kapitalflucht anstatt für produktive Investitionen eingesetzt wurde. Dasselbe Schicksal scheint unausweichlich, wenn sich der Währungsfonds zu einem neuen Hilfspaket für die Argentinier entschliessen sollte.
Doch Argentinien braucht dringend neues Geld, um Auslandschulden zu begleichen. Laut einem Bericht von «El País» liess Milei zumindest einen Teil der staatlichen Goldreserven ins Ausland – mutmasslich nach London – verfrachten, um Renditen zu erzielen, statt es in der Zentralbank zu behalten. Zudem deutete Milei an, dass der Transfer mit der Möglichkeit zusammenhängt, das Gold als Sicherheit für einen Überbrückungskredit zu nutzen. Doch der heimliche Gold-Transfer könnte für das Land böse Folgen haben: Es gibt Befürchtungen, dass ausländische Gläubiger das argentinische Gold aufgrund langjähriger Forderungen beschlagnahmen könnten, berichtet «Telepolis».
Erfreulich sind hingegen die Nachrichten aus Uruguay. Das Land hat solche Malaisen und Missgriffe, die Argentinien immer weiter abrutschen lassen, in den letzten hundert Jahren vermeiden können. Erfolgsgeheimnis ist einerseits die Entwicklung staatlicher Strukturen, wo die Kirche (jeglicher Heilsgeschichte) zwar Freiheit des religiösen Kults geniesst, in der Politik generell und besonders hinsichtlich der Wirtschaftspolitik aber nichts zu sagen hat. Andererseits üben die Banken in dem «Sandwich-Staat» zwischen Argentinien und Brasilien die Funktion eines regionalen Treuhänders aus, der sich um eine adäquate und diskrete Abwicklung der Geldströme im Südzipfel des Erdteils kümmert.
Vor allem aber hält sich das nur 3,5 Millionen Menschen zählende Land an die Regeln einer glaubwürdigen Demokratie. Wie die letzte Präsidentschaftswahl im November vonstatten ging und wie die lokale Bevölkerung mit diesem kostbaren Gut umgeht, zeigt eine Analyse im «IPG Journal» auf. Dabei wird klar, dass das Hin und Her zwischen gemässigt konservativer und pragmatisch linksgerichteter Politik von den jeweiligen Anhängern leidenschaftlich, aber kaum jemals fanatisch oder gar gewalttätig ausgetragen wird. Im Gespräch mit einem Ratgeber des neu gewählten Staatspräsidenten Yamandú Orsi kommt der in Uruguay vorherrschende konziliante Umgang untereinander mustergültig zum Ausdruck.
Im Poker um die Macht in Bolivien zwischen dem früheren Staatspräsidenten und Parteichef Evo Morales und dem jetzigen Präsidenten Luís Arce wird viel über die Schwächen und Sünden des Gegners gestritten – eine Auseinandersetzung, die wenig über die strukturellen Probleme des Andenstaats aussagt. Es ist wohl bezeichnend, dass solche Kritik eher von aussen und von neutraler Seite kommt. Ein gutes Beispiel dafür finden wir in der Analyse eines Technokraten, der sich mit der Rolle von Erdgas und Erdöl in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes auseinandersetzt. Hier wird aufgezeigt, wie der bis 2015 akkumulierte, für lokale Verhältnisse beträchtliche Stock an Devisenreserven in den folgenden Jahren langsam, aber stetig schmolz. Ein derartiger Verschleiss müsste auch für andere Regierungen der Region ein Lehrstück sein, das man nicht ernst genug nehmen kann. Beide Rivalen, Morales wie Arce, unterschätzten das Problem der schleichenden Überbewertung der Lokalwährung (des Boliviano) offenbar gründlich und müssen sich jetzt mit ähnlichen Problemen herumschlagen wie die argentinische Regierung.
Noch betrüblicher ist die politische Entwicklung in Nicaragua, das vor vier Jahrzehnten das Mekka von Entwicklungshelfern und Sympathisanten aus aller Welt war. Die Sandinistische Befreiungsfront (FSLN) galt damals als Hoffnungsträger einer Revolution, die nach einem langen Kampf gegen die Dynastie des Somoza-Clans mit friedlichen Mitteln in die Tat umgesetzt werden sollte. Die USA bekämpften dieses Projekt direkt und indirekt, das heisst mit Sanktionen und der Unterstützung von rechtsradikalen «Contras», bis die Sandinisten bei den Wahlen von 1990 aufgrund vielfältiger Faktoren das Nachsehen hatten. Nun konnte sich der frühere FSLN-Chefkommandant und Expräsident Daniel Ortega als Wortführer der Opposition positionieren und schliesslich 2006 – unter anderem mithilfe des konservativen Klerus – an die Macht zurückkehren. Seither verfolgt er zusammen mit seiner Gattin Rosario Murillo beharrlich und skrupellos das Ziel der Festigung einer Familiendynastie, die sich im Wesentlichen kaum mehr von jener der Somoza-Diktatur unterscheidet. Zur Lage nach bald 20-jährigem Regime Ortega-Murillo liegen uns zwei Einschätzungen vor, die eine von der britischen «BBC Mundo» und die andere von der deutschen Genossenschaftszeitung «taz».
Im Fall Venezuela fällt es immer schwerer, eine nüchterne und objektive Bilanz über die Herrschaft des Autokraten Nicolas Maduro zu ziehen. Seine Weigerung, die offiziellen Akten der Präsidentschaftswahlen vom Juli 2024 aufzudecken und öffentlich bekanntzumachen, hat die Fronten weiter verhärtet. Washington bombardiert Caracas jetzt mit neuen harten Sanktionen, wie eine von «amerika21» verbreitete Reaktion von venezolanischer Seite zeigt. Im lateinamerikanischen Kontext hatten die moderat linken Regierungen von Kolumbien und Brasilien auf eine korrekte Abwicklung des Urnengangs im Erdölstaat gehofft … Vergeblich: Maduro hüllt sich in Schweigen und winkt ab. Aus diesem Grund sind die Beziehungen zu den beiden Nachbarn sichtlich abgekühlt.
Im Vorfeld des Regierungswechsels in den USA wirft das «IPG-Journal» einen Blick auf die von Expräsident Jair Bolsonaro angeführte extreme Rechte in Brasilien. Dass man den «Trump der Tropen» ernst nehmen sollte, illustriert der Autor dieser Hintergrund-Story mit einer Vielfalt von Hinweisen auf dessen persönliche Kontakte und Netzwerkverbindungen. Die Unverfrorenheit dieser Leute, wie sie nach verlorenem Kampf an den Urnen zum Gegenangriff auf Staatschef Lula da Silva und seine sozialdemokratisch orientierte Regierung blasen, lässt nichts Gutes erwarten.
Kaum im Amt, hat das neue Staatsoberhaupt von Mexiko, Claudia Sheinbaum, erste Zeichen gesetzt, dass es bei den von Amtsvorgänger López Obrador entworfenen strukturellen Reformen in der Wirtschaft stramm vorwärtsgehen soll. Wenige Tage nach der Machtübernahme unterschrieb sie Dekrete, wonach sowohl die Erdölgesellschaft Pemex als auch die Elektroholding CFE wieder in staatliche Hände zurückkehren sollen. Laut «amerika21» will sich die Präsidentin für mehr Effizienz in der Führung der beiden Mammutbetriebe einsetzen. Als ehemaliger Bürgermeisterin von Mexiko Stadt mangelt es ihr in dieser Hinsicht nicht. Ob sich Sheinbaums Absicht, die Bevölkerung mit billigerem Benzin, Gas und Strom zu beliefern, aber verwirklichen lässt, ohne dass dabei die nötigen Investitionen in diesen Sektoren vernachlässigt werden, ist eine offene Frage.
____________________________________________
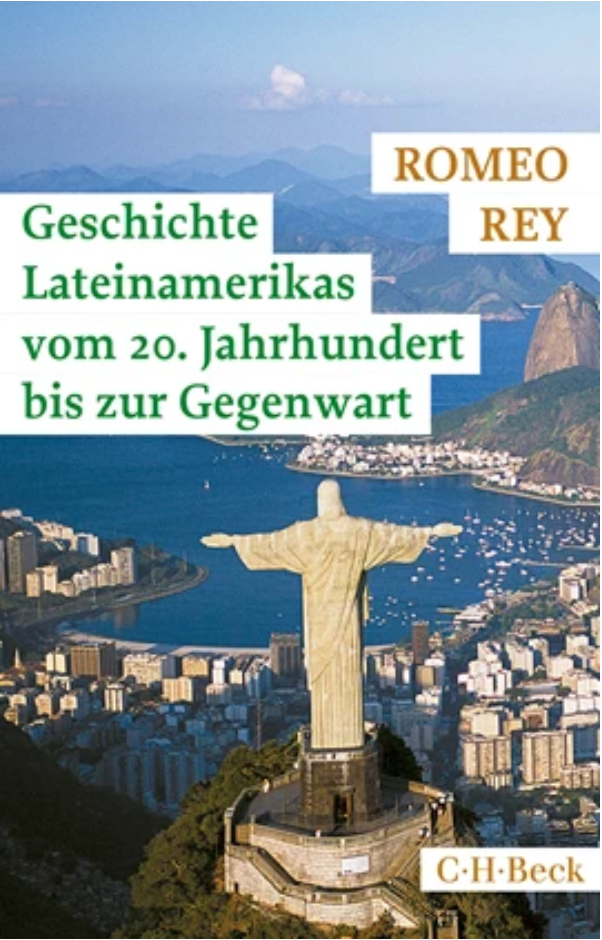
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine. Der Autor war 33 Jahre lang Korrespondent in Südamerika, unter anderem für den «Tages-Anzeiger» und die «Frankfurter Rundschau».
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.









