Lateinamerika: Das Pendel schlägt in alle Richtungen aus
Bei der Präsidentschaftswahl vom 22. Oktober in Argentinien erreichten die Peronisten einen Etappensieg, mit dem die allerwenigsten Beobachter und Meinungsforscher gerechnet hatten. In der ersten Wahlrunde holte Wirtschaftsminister Sergio Massa am meisten Stimmen. Allerdings besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass konservative und ultraliberale Kräfte bei der Stichwahl im November das Ruder noch einmal herumwerfen können.

Ein routinierter Kolumnist der rechtsliberalen Zeitung La Nación dreht die Wahlergebnisse vom Sonntag in alle Richtungen – und doch kann er die Schlussfolgerung nicht vermeiden: Die infolge der wild galoppierenden Inflation und Wirtschaftskrisen verarmten Volksmassen halten dem Peronismus fast 50 Jahre nach dem Tod ihres Caudillos unbeirrt die Treue. Sergio Massa, Wirtschaftsminister der scheidenden Regierung, liegt mit 36 Prozent in Führung, während der bisher als Favorit geltende Ultraliberale Javier Milei knapp unter 30 Prozent hängen blieb.
Argentinien: Wahl zwischen Pest und Cholera
Milei müsste bei der Stichwahl grosse Teile der alteingesessenen Konservativen für sich und seine wirren Regierungspläne gewinnen – nachdem er sie im Wahlkampf als Schuldige der schweren Krise Argentiniens angegriffen und zusammen mit den Peronisten in denselben Topf geschmissen hatte. So oder so ist die gegenwärtige politische Lage für das Bürgertum des Pampastaats ein Horrorszenario: Die Wahl zwischen zwei Populisten, von denen sich der eine (Massa) in seiner politischen Laufbahn schon bei allen möglichen Parteien angebiedert hat, während der andere (Milei) sie allesamt der Regierungsunfähigkeit bezichtigt.
Der (provisorische) Triumph der Peronisten zeichnet sich auch im Landesinnern ab, am stärksten in der Provinz Buenos Aires, die gut ein Drittel aller Stimmberechtigten des Landes stellt. Als wichtigste Sekundanten von Massa erscheinen dort der wiedergewählte Gouverneur Axel Kicillof, auch er ein früherer Wirtschaftsminister, und Expräsidentin Cristina Fernández de Kirchner, beide mit deutlichem Linksdrall. Die Witwe des im Amt verstorbenen Präsidenten Néstor Kirchner scheint sich im fortgeschrittenen Alter als Erbin von Eva Perón profilieren zu wollen.
Das schwerste Erbstück, das fast alle Regierungen seit den Zeiten von Juan Domingo Perón an ihre Nachfolger weitergereicht haben, ist die Inflation. Sie beschleunigt sich derzeit jeden Monat um etwa 15 Prozent mit ungebremst steigender Tendenz. Wie eine populistische Herrschaft der einen oder anderen Couleur dieses gewaltige Problem in den Griff bekommen soll, ist absolut rätselhaft. Dazu gesellen sich massive Forderungen ausländischer Kapitaleigner und Kreditgeber, die den chronisch überschuldeten Staat in die Knie zwingen wollen.
Ecuador: 35-jähriger Milliardärssohn an der Staatsspitze
In den vergangenen Wochen fanden in mehreren Ländern des Subkontinents Urnengänge statt – für die grosse Mehrheit der Stimmberechtigten eine eher seltene Gelegenheit, ihren staatsbürgerlichen Willen nicht nur auf der Strasse kundzutun. Diese Urnengänge zeigten in jüngster Zeit politisch sehr gegensätzliche Tendenzen auf. Während eben noch Vertreter der Linken im Aufwind waren (Bolivien, Kolumbien, Chile, Brasilien, Honduras, Guatemala), schlägt das Pendel neuerdings wieder stärker zugunsten der Rechten aus: so in Paraguay, Uruguay, Ecuador und in Chile bei der letzten Abstimmung über eine neue Staatsverfassung.
Nachdem der Sozialdemokrat Bernardo Arévalo im August nach mehreren Regierungen von erzkonservativen und rechtspopulistischen Parteien die Stichwahl um das Präsidentenamt in Guatemala gewonnen hatte, wähnten sich gemässigte Sozialisten und Sozialdemokraten in einem Revival. Doch die Hoffnung, Arévalos Wahlsieg könnte auch Linke in anderen Staaten der Region inspirieren, erwies sich schon wenige Wochen später als trügerisch. Am 15. Oktober gewann in Ecuador der rechtsgerichtete Kandidat Daniel Noboa die Stichwahl um das Präsidentenamt. Der erst 35-jährige Noboa ist der Sohn eines der reichsten Männer und grössten Bananen-Exporteurs des Landes. Mit seiner Wahl machte die Mehrheit der Bevölkerung deutlich, dass sie lieber dem Milliardärsspross vertraut als dem früheren linksreformistisch gesinnten Staatspräsidenten Rafael Correa, der auf eine Gelegenheit lauert, als starker Mann auf die politische Bühne im Äquatorstaat zurückzukehren.
Besonders unter jungen Wählerinnen und Wählern fand Noboa starken Zuspruch, berichtet das IPG-Journal. Doch für Noboa, der bloss ein 18 Monate dauerndes Restmandat übernimmt, wird der Zugriff auf die Macht kein Zuckerschlecken sein. Das relativ kleine Land, das bis vor etwa einem Jahrzehnt ein Magnet für Rucksacktouristen war, ist – vor allem wegen seiner Nachbarschaft zu Kolumbien – zu einem gefährlichen Tummel- und Umschlagplatz für Drogenbanden geworden.
Venezuela: USA verlangen Wahlgarantien
Das Thema Wahlen wird nach längerer Pause auch in Venezuela wieder aktuell. Zum besseren Verständnis der dortigen Lage müssen wir allerdings eine Notiz über Bemühungen von Staatschef Nicolás Maduro vorwegnehmen, der unter Umgehung der ihm feindlich gesinnten USA und der meisten EU-Staaten die Fühler anderswo nach möglichen Verbündeten ausstreckt. Offensichtlich günstiger sind für ihn die Voraussetzungen im Umgang mit der einst militanten G77 im Verbund mit China, berichtet amerika21.
Zwar sind die nächsten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen erst in einem Jahr. Doch das Seilziehen um die Bedingungen und Garantien dieses staatsbürgerlichen Prozesses hat schon begonnen, und die Vorzeichen sind nicht die besten. Laut einem Bericht der FAZ versucht Washington der Regierung in Caracas bei der Durchführung möglichst genau auf die Finger zu schauen (was bei Wahlen anderswo dank der Dominanz konservativer lokaler Kräfte in der Regel nicht als nötig erachtet wird). Gleichzeitig ist das Interesse der USA an Venezuelas Erdöl wieder erwacht, seit die OPEC+, das Kartell der wichtigsten Produzenten des Schwarzen Goldes, mit der Mitgliedschaft von Russland und Saudi-Arabien verstärkt wird und der Ölpreis steigt.
Mexiko: Eine Frau wird wohl nächstes Staatsoberhaupt
Ebenfalls noch in gebührlicher Distanz liegen die nächsten allgemeinen Wahlen in Mexiko. In diesem Staat, der das Scharnier zwischen Mittel- und Nordamerika bildet, herrscht eine ganz eigene Spielregel: Der abtretende Staatspräsident nominiert seinen Nachfolger im Amt selber und stellt ihn dem Stimmvolk zur Bestätigung an den Urnen vor. So funktioniert das seit rund 100 Jahren. Das pikante Detail an dieser bisher unangefochtenen Praxis ist die Tatsache, dass nun zum ersten Mal in der Geschichte des Landes der Kandidat – eine Frau ist. Mehr noch: In einem der Mutterländer des Machismo ist Claudia Sheinbaum Favoritin für das Präsidentenamt, schreibt das IPG-Journal. Zudem bemerkenswert: Dass Mexiko eine Präsidentin bekommen wird, steht auch deshalb quasi fest, weil das wichtigste Oppositionsbündnis ebenfalls mit einer Frau – der Senatorin Xóchitl Gálvez Ruiz – antritt. Beide Kandidatinnen liegen programmatisch nicht weit auseinander. Beide wollen in die Fussstapfen des abtretenden Präsidenten Andrés Manuel López Obrador treten. Dieser wiederum hat nie verschwiegen, dass er mit der Gleichberechtigung der Geschlechter ernst machen wolle.
Welches wirtschaftspolitische Erbe Obrador der künftigen Präsidentin hinterlassen wird, ist in der Neuen Zürcher Zeitung nachzulesen. Da wird Mexiko bereits als boomendes Land gefeiert – was nach den Erfahrungen in Lateinamerika nicht nur vorbehaltlose Zustimmung verdient. Wo immer solch imposante Wachstumszahlen genannt werden, ist Vorsicht geboten und die Frage zu stellen, wie sie zustande gekommen sind. Auch wenn also nicht alles für bare Münze zu nehmen ist, kann sich dieses Erbe sehen lassen. Wie einem Bericht von amerika21 zu entnehmen ist, haben zwischen 2020 und 2022 8,9 Millionen Menschen in Mexiko die Armut überwunden. Das könnte ein vielversprechender Ausgangspunkt für die Fortsetzung von López Obradors Reformpolitik sein.
Bolivien: Morales’ MAS-Partei in der Krise
Innenpolitische Stabilität ist ein ebenso wichtiger Faktor wie die wirtschaftspolitische Kontinuität. Sie hat seit dem unrühmlichen Ende der Militärdiktaturen in Lateinamerika, also seit Mitte der 1980er Jahre, in vielen Ländern des Erdteils mitgeholfen, die demokratischen Strukturen und Praktiken innerhalb des bestehenden Systems zu stärken. Das trifft vor allem auf Bolivien zu, das früher als «Land der hundert Revolutionen» galt. Diese Stabilität gerät jetzt aber in diesem Andenstaat immer mehr ins Wanken.
Zwei journalistische Beiträge beschreiben den Machtkampf im Schosse der MAS-Partei (Movimiento al Socialismo), die in Bolivien seit 2005 fast ununterbrochen herrscht. BBC Mundo erzählt die Geschichte sachlich und objektiv in den hauptsächlichen Linien. Wer die politischen und menschlichen Hintergründe dieser Krise mit allen Feinheiten kennen will, sollte sich mit der längeren Version (ebenfalls auf Spanisch) befassen, die uns Nueva Sociedad vorlegt.
Für die Anhänger des bolivianischen Modells – das diesen Namen durchaus verdient (2005 bis etwa 2016) – ist diese Entwicklung betrüblich. Man soll Evo Morales, dem Begründer und lange unbestrittenen Chef der Bewegung gewisse Verdienste nicht aberkennen. Man kann aber auch nicht übersehen, dass seine Figur heute in der einheimischen Linken und indigenen Bevölkerung mehr Dissens als Konsens erzeugt. Morales’ kapitalster Fehler bestand darin, dass er seine dritte oder vierte Wiederwahl (je nach Zählmodus) erzwingen wollte und die Alleinherrschaft anstrebte. Ein Verhalten, das in krassem Widerspruch zur Verfassung und zum Wahlgesetz steht. Dieser Fehler wirkt bis in die Gegenwart nach, und der Fettfleck lässt sich weder wegbürsten noch weisswaschen.
Einigkeit herrscht in der Regierungspartei und in der Opposition in Sachen Drogenpolitik des Landes. Im Andenstaat ist der Anbau von Koka-Pflanzen legal. Mehrfach haben die Vereinigten Staaten interveniert und versucht, sich in die nationale Drogenpolitik einzumischen. Das kommt bei der bolivianischen Regierung gar nicht gut an, wie amerika21 berichtet. Immerhin kann die Regierung in La Paz für sich beanspruchen, dass sie mit ihren Verfügungen gewalttätige Zustände wie in Kolumbien, Mexiko und zunehmend auch in Ecuador vermeiden konnte. Von amtlicher Seite verweist man zu Recht auf die unbändige Nachfrage im weltweiten Rauschgifthandel, und dafür seien in erster Linie die reichen Gesellschaften im Norden verantwortlich.
__________________________
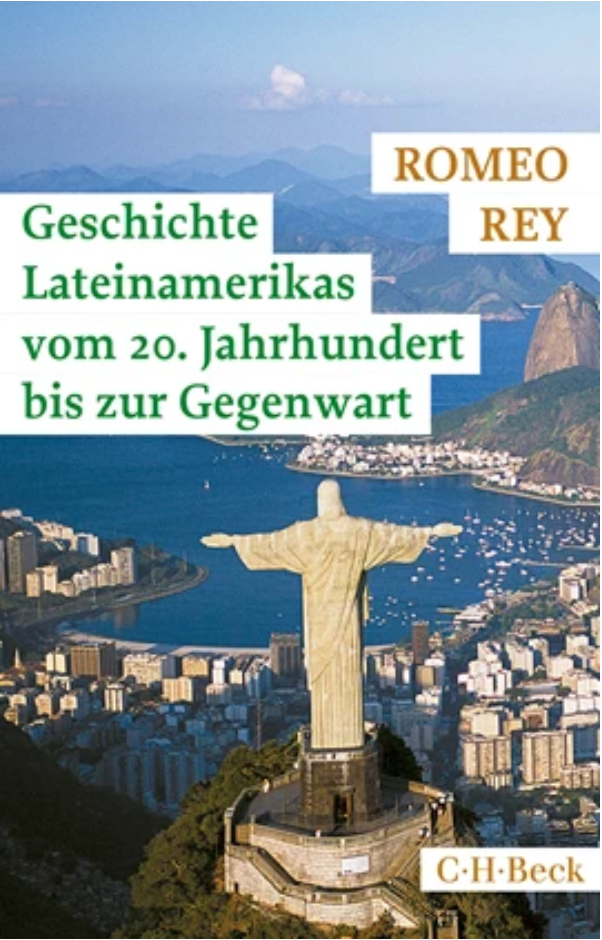
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine. Der Autor war 33 Jahre lang Korrespondent in Südamerika, unter anderem für den «Tages-Anzeiger».
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.









