Fremdwörter – Gefahr für Schreiber und Leser
Im ersten Teil dieser Serie ging es darum, dass manche Menschen so sprechen und schreiben, dass sie beeindrucken, und nicht so, dass sie verstanden werden. Zum Beeindrucken dienen häufig Fremdwörter.
Ein Beispiel aus der «Berner Zeitung»: «Kommt die Schweiz final zu diesem Schluss, kann sie der spanischen Justiz die Unterstützung verweigern.» Mit «final» und «zu diesem Schluss» ist eigentlich zwei Mal das Gleiche gesagt. Aber «final» klingt natürlich klug.
Der grünliberale Aargauer Nationalrat Beat Flach sagte letzten Herbst nach der gewonnenen Autobahn-Abstimmung, er und seine Mitstreiter seien «faktenbasiert unterwegs» gewesen. Er hätte auch einfach sagen können, sie hätten sich «an die Tatsachen gehalten».
Noch schlimmer als Fremdwörter sind englische Ausdrücke. Die «Berner Zeitung» brachte es zustande, in einem einzigen Artikel zehnmal den Begriff «social freezing» zu verwenden. Dabei ging es nicht darum, dass jemand eine Beziehung auf Eis legen würde. Es ging um nichts Gesellschaftliches und um nichts Soziales, sondern ums Einfrieren unbefruchteter Eizellen. Warum also nicht auf Deutsch? Die Chancen, dass Leser und Leserinnen das verstanden hätten, wären grösser gewesen.
Hier finden Sie den zweiten Teil der alphabetischen Liste (E bis G) von Wörtern, die es zu vermeiden gälte:
- Eigner: Das ist ein «Eigentümer». Oder vielleicht auch nur ein «Besitzer».
- einordnen: «Wir ordnen ein.» Es vergeht kaum eine «10-vor-10»-Sendung am Fernsehen SRF, in welcher der Moderator oder die Moderatorin dieses Versprechen nicht abgibt. Dabei stehen keine Ordner auf dem Tisch, und es hat auch kein Regal an der Wand. In den Fernsehsendungen wird nichts «eingeordnet», sondern «erklärt». Bestenfalls.
- emissionsintensiv: «Stinkt» es? Ist es «lärmig»? «Verpestet» jemand die Luft? «Vergiftet» einer die Böden? Es gäbe so viele schöne Wörter, die mehr sagen.
- emotional: Radio SRF berichtete über eine Frau, deren Mann bei einem Erdbeben umgekommen war. An seinem Todestag werde sie immer «emotional». «Emotional» ist ein Oberbegriff, der wenig aussagt. Ist die Frau «traurig», «niedergeschlagen», «unglücklich» oder sogar «verzweifelt»?
- Entlastungspaket: Wie wär’s mit «Sparpaket»?
- Erzählung: Die «Erzählung» ist der Bruder des «Narrativs». Die «Erzählung» hat gegenüber dem «Narrativ» den Vorteil, dass das Wort auch für Nicht-Lateiner verständlich ist. Aber sonst: Die «Erzählung» ist genau so perfid wie das «Narrativ». Wer von einer «Erzählung» oder einem «Narrativ» spricht, der unterstellt, dass etwas faul ist. Deshalb: Warum nicht gleich «Behauptung», «Gerücht», «Märchen», «Lügengeschichte»? Damit wäre das Problem benannt.
- Expats: In der Regel reiche Ausländer, die sich gar nicht Mühe geben, sich einzuleben. Wenn es so ist, kann man es auch so sagen.
- Expertise: Ist einfach «Fachwissen».
- Event: Das ist ein «Anlass», eine «Veranstaltung», ein «Fest», eine «Feier», vielleicht ein «Konzert».

- Fachkräftemangel: Warum nicht einfach «Personalmangel»? Oft geht es ja gar nicht um «Fachkräfte». Aber um «Personal» geht es immer.
- Fachexperte: Es gibt «Fachleute» und es gibt «Experten». Aber «Fachexperten»?
- Fachspezialist: Siehe oben: Es gibt «Fachleute» und es gibt «Spezialisten». Aber «Fachspezialisten»?
- Fallzahlen: Warum nicht «Fälle»? Das reicht eigentlich.
- Feuerwehrpersonen: Radio SRF berichtete, dass die «Feuerwehrpersonen» den Waldbränden in Kalifornien machtlos gegenüberstünden. Ein schönes Beispiel für verunglückte geschlechtergerechte Sprache. Denn seit jeher gibt es das Wort «Feuerwehrleute». Das ist durchaus geschlechtergerecht.
- final: siehe Haupttext oben.
- Finanzen: Das ist «Geld».
- Finanzielle Mittel: Das auch.
- fit: Ist ein Allerweltswort geworden. Da werden «Mitarbeiter fit für den Arbeitsmarkt gemacht», «touristische Attraktionen fit für die neue Saison» und Angestellte «fit für die immer neuen digitalen Anforderungen». Und als ob das nicht reichen würde, werden bei einer Hausrenovation auch noch «die Metallgriffe in Kleinarbeit fit gemacht». Werden sie «geschliffen», «gestrichen» oder «verstärkt»? Und die Menschen: «geschult», «unterrichtet» oder «angelernt»? Fit bedeutet alles. Und nichts. Das Wort ist unbrauchbar.
- fixen: Machten früher Drogensüchtige. Jetzt tun es Wichtigtuer mit voller Agenda. Sie entlehnen das Wort aus dem Englischen. Sie könnten auch sagen: «abmachen» oder «vereinbaren».
- flächenintensiv: Beschönigender Immobilien-Branchenjargon. Bedeutet eigentlich, dass unverschämt viel Boden überbaut wird.
- Freiwilligenarbeit: Die meisten Leute arbeiten «freiwillig». Sie könnten auch die Stelle wechseln. Sie sind ja nicht Sklaven. Gemeint ist «ehrenamtliche Arbeit», «unentgeltliche» oder «unbezahlte Arbeit».
- frontal: «Murdoch frontal angegriffen», meldete das «St. Galler Tagblatt». Ob «frontal» oder «lateral» ist egal. Wichtig ist eigentlich nur, dass der Verleger «angegriffen» wurde. Wichtiger wäre, ob er mit Worten oder mit Taten angegriffen wurde.
- Funktionalität: Die Postfinance rühmte sich kürzlich, dass sie eine neue «Funktionalität» anbiete. Sie verwendet ein Wort, das für alle, die blenden wollen, wie geschaffen ist. «Funktionalität» bedeutet hier nichts anderes als «Funktion».
- Fussabdruck: Unfreiwillig komisch berichtete Radio SRF über Minenprojekte in Schweden: «Eine neue Mine hat immer einen grossen Fussabdruck.» Stattdessen hätte SRF melden können: «Eine neue Mine führt immer zu grossen Umweltschäden.» Das wäre leichter verständlich. Und nicht absurd.

- Gastgeber: Modewort. Es geht um einen «Wirt». Oder um einen «Hotelier».
- Gastronom: Auch ein Modewort. Immerhin kann hier nur ein «Wirt» und nicht auch noch ein «Hotelier» gemeint sein.
- Gebäulichkeit: Wörter mit den Nachsilben «-lich» und «-keit» sind hässlich. Immer. Warum nicht einfach «Haus», «Bau», «Baute»? Und wenn es unbedingt eine Nachsilbe sein soll: «Liegenschaft.» Oder mit Vorsilbe: «Gebäude.»
- gefühlt: Der «Blick» teilte seinen Lesern mit: «Gefühlt wird das Fliegen teurer.» Die Leser hätten wohl gerne gewusst, ob es nur «gefühlt» oder «tatsächlich» teurer werde. Und am besten gleich auch noch um wie viel.
- Gemengelage: SRF meldete: «In dieser Gemengelage traf Wirtschaftsminister Robert Habeck mit seiner vielbeachteten Videorede einen Nerv.» Die «Gemengelage» ist ganz einfach eine «Situation», vielleicht auch ein «Durcheinander».
- generieren: Ist ein Modewort. Bundesrat Albert Rösti sagt: «Floriert die Wirtschaft, generiert das Steuereinnahmen.» Das gibt der banalen Aussage ein bisschen mehr Gewicht. Eigentlich bedeutet der Satz bloss: «Die blühende Wirtschaft bringt höhere Steuereinnahmen.» Weitere Alternativen zu «generieren»: «erzeugen», «herstellen», «erschaffen», «zeitigen».
- geopolitisch: Das ist Politjargon. «Weltpolitisch» täte es auch.
- geopolitische Verwerfung: SRF meldete: «Auf geopolitische Verwerfungen kann die Landesregierung bekanntlich wenig Einfluss nehmen». Und meinte: «Kriege».
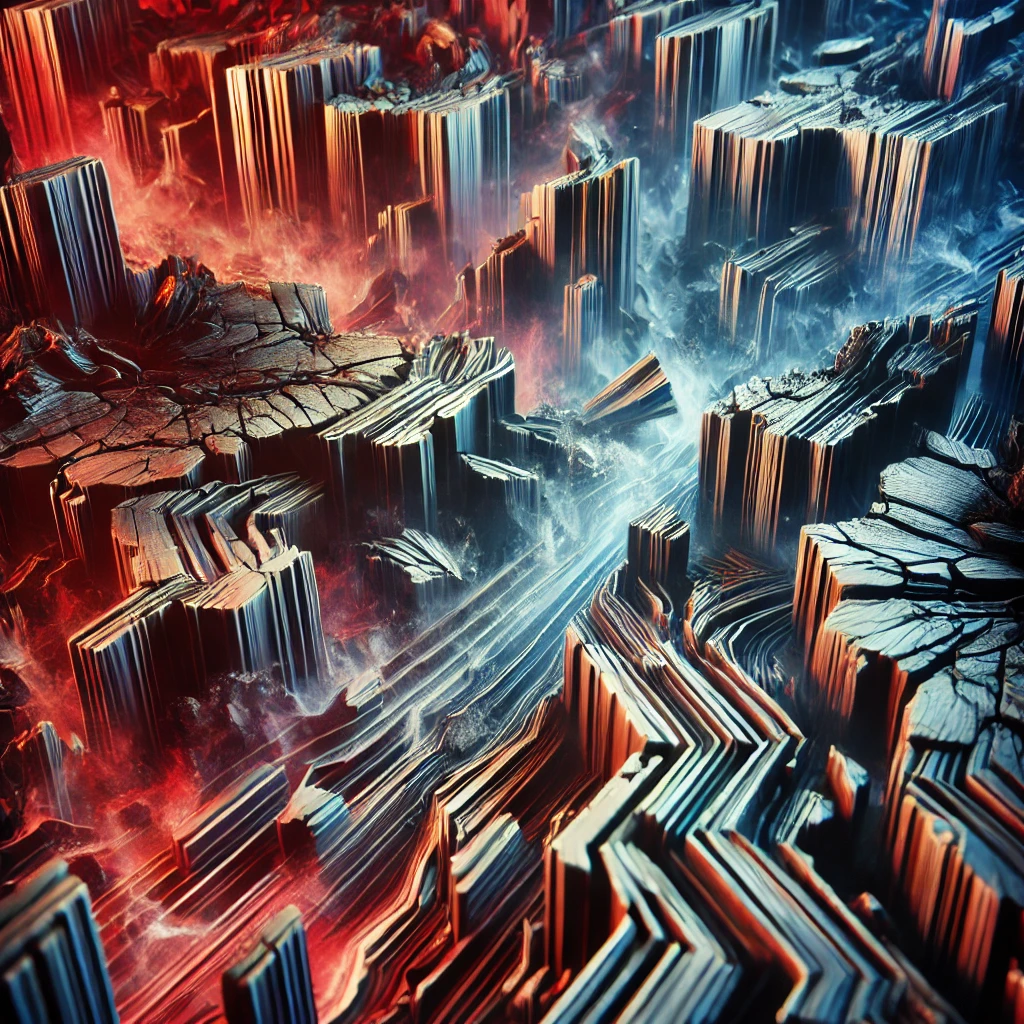
- global: Lässt sich gut vermeiden. Bedeutet: «weltweit.»
- globaler Süden: Die Bezeichnungen «Entwicklungsländer» oder gar «Dritte Welt» gelten heute als inkorrekt. Der Begriff «globaler Süden» ist als Ersatz aber untauglich. Kaum jemandem dürfte nämlich bewusst sein, dass zwei der südlichsten Länder überhaupt – Australien und Neuseeland – zum «globalen Norden» gehören. Albanien und die Ukraine – je nach Definition – hingegen zum «globalen Süden».
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.










Ach es ist immer eine Satisfaktion, wenn möglichst viele Abstrakta und Fremdwörter operationalisiert werden. Und Passiva, da ist keine Kenntisnahme oder Reflexion darüber nötig, wer das operierende Subjekt ist. Und es ist immer gut, wenn alles im «ist-Status» fixiert wird, weil dann die Recherche nach passenden Verben verunnötigt ist. Das ist säb: das ist ein simpleres understanding als der Prozess der Genese. So ist der Leser fit und voll empathisch akzeptiert, in Dankbarkeit! CC
Schön gesagt.
Meine Wetter-App teilt mir stets noch die «gefühlte» Temperatur mit. Ich warte auf den Zusatz «Wenn Sie sich splitterfasernackt vor die Haustür stellen, sinkt die gefühlte Temperatur um 10 Grad. Falls Sie sich jedoch mit Daunenjacke, Handschuhen und Mütze ausrüsten, steigt sie um 10 Grad.»
Muss ich mir künftig die Temperaturangaben vom Psychologen mitteilen lassen?
Humorvoller Artikel, und humorvolle Kommentare darunter! Das Land des globalen Südens, das am weitesten im Norden liegt, ist wohl Russland, als BRICS-Mitglied (oder Member?) definitiv auf Seiten der ehemaligen Kolonien. Schwierig nur, dass andere Begriffe wie Globale Mehrheit sehr vage sind, Entwicklungsland bezieht sich auf die wirtschaftliche Stärke, nicht auf die politische Ausrichtung. Man könnte einfach sagen, «alles ausser der Weltgemeinschaft», denn mit Weltgemeinschaft meinen westliche Medien eigentlich immer nur die USA, Europa, Australien, und vielleicht noch Neuseeland, Japan und Südkorea. Der Rest ist wohl die «Nicht-Weltgemeinschaft». Oder die «Weltfreundlichschaft»?