mRNA-Impfung für Schwangere: Studie enthielt groben Fehler
Vor der Zulassung der Covid-Impfstoffe wurden diese nicht an Schwangeren getestet. Unter dem Eindruck, dass das Coronavirus bei Schwangeren – vor allem solchen mit Risikofaktoren – eher zu schweren Krankheitsverläufen führte, hielt die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) im Mai 2021 dazu an, Schwangere «priorisiert» gegen Covid zu impfen. Zu den Sponsoren der DGGG gehört Pfizer. Zehn weitere ärztliche Fachgesellschaften und Arbeitsgruppen schlossen sich ihrer Empfehlung an (siehe Kasten unten). Damit setzten sie sich über die damals geltende Empfehlung der deutschen Impfkommission hinweg.
Als einen der wenigen, wichtigen Belege für die Sicherheit der mRNA-Impfung bei Schwangeren führten die Fachgesellschaften eine Studie der US-Gesundheitsbehörde CDC an. Sie war am 21. April 2021 im «New England Journal of Medicine» erschienen. Für diese Studie wurden geimpfte Schwangere, die sich an einem freiwilligen Meldesystem per Handy beteiligten, mehrmals telefonisch kontaktiert. Wie oft dies geschah, wurde nicht mitgeteilt. Die Studienautoren erwähnten nur, dass eine «begrenzte Anzahl von Anrufen» getätigt worden sei. Auch Daten aus anderen Meldesystemen zu vermuteten Nebenwirkungen flossen in die Studie ein.
Im Allgemeinen ist ein Nachfragen verlässlicher als die üblichen Meldesysteme, bei denen Behörden darauf warten, dass Ärzte oder Betroffene vermutete Nebenwirkungen selbst melden. Doch diese «vorläufigen Befunde zur Sicherheit der mRNA-Covid-19-Impfung bei schwangeren Personen» – so der Titel der Studie – hatten erhebliche Mankos.
Als Resultat der Umfrage erklärten die CDC-Studienautoren: «Vorläufige Resultate zeigten bei schwangeren Personen keine offensichtlichen Warnsignale.» Die Worte «vorläufige» und «offensichtliche» liessen nicht auf ein Resultat schliessen, das Schwangeren Sicherheit bietet.
Sogar schon bevor diese Daten vorlagen, hatte die US-Behörde CDC bereits am 7. Januar 2021 informiert: «Aufgrund des Wirkmechanismus der mRNA-Impfstoffe glauben Experten, es sei «unwahrscheinlich», dass die mRNA-Impfstoffe ein spezifisches Risiko für Schwangere darstellen.»
Ein grober Rechenfehler, der allen durch die Lappen ging
Auf die weit herum zitierte CDC-Studie beriefen sich ärztliche Fachgesellschaften und Behörden vieler Länder, auch die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Sie diente ihnen als eine wichtige Grundlage, um Schwangeren die mRNA-Coronaimpfung zu empfehlen.
Doch diese Studie enthielt einen eklatanten Rechenfehler. Er war offensichtlich weder den Autoren, noch den Gutachtern, noch der Redaktion dieser renommierten Ärztezeitschrift, noch der Editorialistin, noch den allermeisten derer, welche diese Studie zitierten, aufgefallen.
Laut der Studie sei es bei 12,6 Prozent der Frauen, die kurz vor oder kurz nach Beginn der Schwangerschaft geimpft wurden, zu einer Fehlgeburt vor der 20. Schwangerschaftswoche gekommen. Diese Rate lag im Bereich des Üblichen. Doch die Studienautoren hatten für diese Risikoberechnung den falschen Nenner gewählt.
Rechnete man es korrekt, dann hatten 82 Prozent dieser Frauen eine Fehlgeburt. Das sei eine «alarmierende Inzidenz, drei- bis achtmal höher als in der Vergleichspopulation», bemerkten später Wissenschaftler – und auch Impfskeptiker.
Viele Daten fehlten
Zudem wussten die Studienautoren bei fast 96 Prozent der Studienteilnehmerinnen, die kurz vor der Schwangerschaft oder bereits in den ersten beiden Schwangerschaftsdritteln geimpft worden waren, noch nicht, wie es mit der Schwangerschaft weiterging. Bei denen, die erst im letzten Schwangerschaftsdrittel geimpft worden waren, wussten sie es nur von rund 70 Prozent.
Eine weitere Lücke: Bei den Fehlgeburten wurde nicht angegeben, mit welchem der beiden mRNA-Impfstoffe die Frauen geimpft worden waren. Diese Unterscheidung der Impfstoffe wurde bei anderen Nebenwirkungen gemacht.
Die Studie erfasste überdies nicht einmal fünf Prozent der geimpften Schwangeren und war nicht repräsentativ.
Sie liess auch keine Schlüsse zu, ob die mRNA-Impfungen zu mehr Fehlgeburten oder mehr angeborenen Fehlbildungen führten und ob sie insbesondere im ersten Drittel der Schwangerschaft sicher sind. In diesem ersten Drittel bilden sich beim Kind die Organe.
Trotzdem schrieb die Editorialistin im «New England Journal of Medicine»: «Dies sind beruhigende Daten, die auf Berichten von schwangeren Frauen beruhen, die meist im dritten Trimester geimpft wurden.»
Schweizer Behörde entwarnte vorschnell
Offensichtlich prüften auch die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, das BAG und die Impfkommission die CDC-Studie nicht auf Schwachstellen. In einer gemeinsamen Erklärung schrieben sie Ende Mai 2021: «Bisher sind in den USA weit über 200’000 schwangere Frauen mit den mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 geimpft worden, ohne dass es Hinweise auf unerwartete Nebenwirkungen auf Mutter und Kind gab. Ende April 2021 wurde eine […] Registerstudie an über 35’000 geimpften Schwangeren publiziert, welche keine Hinweise auf direkte oder indirekte schädliche Wirkungen der Impfung in Bezug auf Schwangerschaft, embryonale/fötale Entwicklung, Geburt oder postnatale Entwicklung zeigt.»
Das war vollmundig. Denn bei dem freiwilligen US-Meldesystem waren zwar über 35’000 Schwangere registriert. Doch die Zahl der tatsächlich ausgewerteten Daten waren viel kleiner: Die Studienautoren wussten damals nur gerade bei 827 Schwangerschaften, wie diese ausgegangen waren. Und 700 dieser Frauen waren erst im letzten Drittel der Schwangerschaft geimpft worden. Immerhin wurde Frauen in der Schweiz zum damaligen Zeitpunkt davon abgeraten, sich im ersten Schwangerschaftsdrittel gegen Covid impfen zu lassen. Allen anderen Schwangeren wurde es ermöglicht und jenen mit Risikofaktoren empfohlen.
Vertrauen in die Impfung verloren
Nicole S.* wusste von alldem nichts. Ihr sei gesagt worden, dass die mRNA-Impfung sicher sei, und darauf habe sie vertraut. Ende August 2021 liess sich die damals 24-Jährige zum zweiten Mal mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech gegen Covid impfen. Etwa zwei Wochen danach wurde sie schwanger. In der neunten Schwangerschaftswoche kam es zur Fehlgeburt. Die Arzneimittelbehörden wissen davon bis heute nichts. Denn weder ihre Frauenärztin noch S. erstatteten eine Verdachtsmeldung. S. nahm auch an keiner Studie teil.
Gab es einen Zusammenhang mit der Impfung, fragt sich S. noch heute. Im Nachhinein, sagt sie, würde sie sich nicht mehr impfen lassen. «Zum einen, weil man mittlerweile von so vielen Nachwirkungen von der Impfung hört. Zum anderen, weil diese ganze Welle von Corona dann so plötzlich aufhörte und es danach niemanden mehr interessierte, ob man geimpft war oder nicht.»
Als die Impfaktion längst lief, gestanden die Autoren ihren Fehler ein
Im September 2021 – da war das Impfen Schwangerer längst im Gang – gestanden die Studienautoren ihren Rechenfehler ein und korrigierten sich. Im April hatten sie noch geschrieben, dass die Rate an Fehlgeburten bei den geimpften Frauen vergleichbar derjenigen aus früheren Studien vor der Pandemie sei. Nun löschten sie diese Aussage.
Die Editorialistin hielt nun neu ebenfalls fest, dass man zu Fehlgeburten keine Schlüsse ziehen könne. Zuvor hatte sie nur bezüglich der angeborenen Fehlbildungen und anderer potenziell seltener Folgen beim Baby darauf hingewiesen, dass man noch keine definitiven Schlüsse ziehen könne.
Ausserdem legten die Studienautoren des CDC nun offen, dass sie von 1224 Frauen, die um die Zeit der Empfängnis oder in der Frühschwangerschaft geimpft worden waren, bei 905 (das entspricht 74 Prozent) gar nicht gewusst hatten, wie es mit der Schwangerschaft weitergegangen war. (Deshalb stimmte auch die Fehlgeburtenrate von 82 Prozent nicht. Sie war zwar korrekt berechnet, beruhte aber nur auf einer Minderheit dieser Frauen.)
Aktualisierte Zahlen zeigten nichts Beunruhigendes
Gleichzeitig lieferten die Studienautoren aktualisierte Zahlen. Diese zeigten, dass die Rate an Fehlgeburten im Bereich dessen lag, was auch ohne Covid-Impfung zu erwarten gewesen wäre. Auch die Dunkelziffer hatte sich verkleinert: Nun wussten sie nur noch bei 10 Prozent der Frauen nicht, wie es weiterging mit der Schwangerschaft.
«Das Risiko eines Spontanaborts zwischen der 6. und 20. Schwangerschaftswoche scheint mit den Werten übereinzustimmen, die für historische Kohorten veröffentlicht wurden», stellten zwei polnische Wissenschaftler im «Journal of Reproductive Immunology» fest. Sie kritisierten die vorschnelle Publikation, die falsche Berechnung und weitere Punkte heftig. Auch die aktualisierten Ergebnisse seien nicht repräsentativ für die Allgemeinbevölkerung, gaben sie zu bedenken.
Studien mit Schwangeren «dringend notwendig»
Einig waren sich Kritiker und Studienautoren in einem Punkt: Es braucht eine längere Nachbeobachtungszeit geimpfter Schwangerer und vollständige Daten, inklusive der Frauen, die um den Zeitpunkt der Empfängnis oder in der Frühschwangerschaft geimpft wurden. Im März 2024 kündigten die Studienautoren «in Kürze» weitere Ergebnisse an. Doch bis heute gibt es kein Update der Resultate dieser Studie zu schwangeren Frauen. Man warte auf die Freigabe durch die CDC, heisst es auf Nachfrage. Doch selbst wenn irgendwann aktualisierte Ergebnisse veröffentlicht werden, bleibt ein grundsätzliches Problem: Viele Frauen konnten für eine Nachfrage nicht erreicht werden, die Studie ist nicht repräsentativ, viele Daten fehlen und es gibt diverse Faktoren, welche die Resultate verzerren können.
Die Editorialistin im «New England Journal of Medicine» (NEJM) forderte: Es sei «dringend notwendig», die Nachbeobachtung von geimpften Schwangeren zu intensivieren, so dass viel mehr Frauen erfasst würden, und es seien Schwangere in Studien einzubeziehen. Eine solche Studie von Pfizer sei ja bereits im Gang. Doch diese Studie ist ein eigenes Kapitel.
➞ Lesen Sie demnächst mehr dazu.
Auf dürftiger Datenbasis Empfehlungen abgegeben
Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und weitere ärztliche Fachgesellschaften schrieben im Mai 2021:
Die COVID-19-Impfung von Schwangeren mit mRNA-basierten Impfstoffen …
- führt nicht vermehrt zu schwangerschaftsspezifischen Komplikationen
- führt nicht zu einem erhöhten Erkrankungs- oder Sterberisiko für die Schwangere oder die Föten
- erfordert keine Stillpause oder -verzicht, da die mRNA des Impfstoffes nicht in der Muttermilch nachgewiesen werden konnte.
Die ärztlichen Fachgesellschaften stützten sich auf fünf teilweise fragwürdige Quellen:
- Quelle Nummer 1 war das Register der US-Gesundheitsbehörde CDC mit 100’599 registrierten Frauen. 4711 Schwangerschaften seien per Ende April 2021 analysiert gewesen. Das entspricht 4,7 Prozent. Wie viele dieser Schwangerschaften noch im Gang und wie viele bereits beendet waren, wurde nicht erwähnt.
- Quelle Nummer 2 war die oben erwähnte Studie der CDC im «New England Journal of Medicine» mit dem Rechenfehler.
- Quelle Nummer 3 war eine Studie im «American Journal of Obstetrics & Gynecology» mit 84 schwangeren, 31 stillenden, and 16 nicht schwangeren Frauen, die damals als Vorabdruck vorlag. Dort wurden die Antikörperwerte gemessen. Am Ende der Studie wird diversen Einrichtungen gedankt, unter anderem dem Institut, das Anthony Fauci leitete, der Gates-Stiftung und der Musk Stiftung.
- Quelle Nummer 4 war eine Studie, die damals als Vorabdruck vorlag und nachwies, dass keine Impf-mRNA in die Muttermilch gelangt. Diese später in «Jama Pediatrics» publizierte Studie wurde inzwischen mehrfach widerlegt. Der mRNA-Fund in der Muttermilch bedeutet nicht automatisch, dass dies ein Risiko für das Baby ist. Aber er müsse weiter abgeklärt werden, waren sich verschiedene Wissenschaftler einig.
- Quelle Nummer 5 war eine Stellungnahme des «European Network of Teratology Information Services» (Entis). Entis befürwortete die Impfung von Frauen, die sich ein Kind wünschten (inklusive der Impfung um den Zeitpunkt der Empfängnis) oder die bereits schwanger waren. Entis schrieb am 14. April 2021:
«Bislang gibt es keine Hinweise auf ein Risiko für den Embryo oder den Fötus durch eine Covid-Impfung in der Schwangerschaft. Tatsächlich dokumentierte Daten über lebend geborene Kinder, die in der Gebärmutter Covid-19-Impfstoffen ausgesetzt waren, sind spärlich (etwa 250), aber beruhigend.»
Entis stützte sich seinerseits auf:
- Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC vom März 2021. Diese stammten von dem Studienautor, der den Rechenfehler im «NEJM» mit zu verantworten hat. Die von «Entis» angegebene Website ist nicht mehr aufrufbar.
- einen Meinungsartikel in der US-Ärztezeitschrift «Jama» vom Februar 2021. Die Autorinnen betonten, wie wichtig Studien mit Schwangeren seien. Es gebe zwar keine Studien, die untersucht hätten, ob der Impfstoff den Fötus erreiche, aber es sei «wahrscheinlich», dass die Muskelzellen an der Einstichstelle den Impfstoff aufnehmen würden.
Mittlerweile ist allerdings klar, dass der Impfstoff nicht im Muskel verbleibt. Die mRNA oder das infolge der Impfung gebildete Spike-Protein wurde schon an diversen Orten im Körper gefunden.
Was das Stillen betraf, zitierten die Autorinnen die «Academy of Breastfeeding Medicine»: Es sei unwahrscheinlich, dass der Impfstoff in den Blutkreislauf gelange und das Brustgewebe erreiche. «Und wenn doch, ist es noch unwahrscheinlicher, dass entweder das intakte Nanopartikel oder die mRNA in die Milch übergehen.» Wie erwähnt, wurde dies mittlerweile widerlegt. - einen Meinungsartikel im «American Journal of Obstetrics & Gynecology» vom Januar 2021. Die Autorinnen forderten, dass «die Covid-Impfung schwangeren Frauen angeboten werden sollte, nachdem erörtert wurde, dass Daten zur Sicherheit fehlen».
- einen Kommentar in der Fachzeitschrift «Vaccine» vom 4. Dezember 2020, also vor der Zulassung der mRNA-Impfstoffe, die an Schwangeren gar nicht getestet worden waren. In dem Kommentar forderten die Autorinnen: «Es ist von entscheidender Bedeutung für die gesundheitliche Chancengleichheit, dass schwangeren Individuen gezielt und ohne Verzögerung Impfstoffe gegen Sars-CoV-2 angeboten werden.»
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.









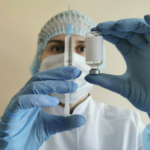
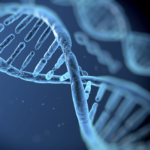


Würde das nicht zumindest zum Teil, die „fehlenden Kinder“ die wir derzeit in Statistiken beobachten erklären? Aber diese Frage wurde ja im Grunde schon in Teil 4 beantwortet. Nur wollen davon scheinbar nur ganz wenige etwas hören. 🙁