Medien empfehlen: Impfen gegen Demenz
Red. – Dies ist ein Gastbeitrag von Professor Pietro Vernazza. Er war bis Sommer 2021 Chefarzt der Infektiologie/Spitalhygiene am Kantonsspital St.Gallen. Sein Artikel erschien zuerst auf seiner Website «infekt.ch». Infosperber veröffentlicht hier eine ausführlichere Fassung.
_____________________
Aktuell rollt eine mediale Welle durch die Schweiz (und die halbe Welt), die eines suggeriert: Mit der Impfung gegen Gürtelrose könne man auch das Risiko für Demenz senken. Man fragt sich, was wohl dahinter steckt.
«Die Gürtelrose-Impfung schützt auch vor Demenz», titelte zum Beispiel die «NZZ» am 5. April 2025. Auch «CH-Media» stellt in einer als Publireportage gekennzeichneten Werbeanzeige die Frage: «Kann die Gürtelrose-Impfung das Demenzrisiko senken?» – um dann im Text mit einem ziemlich entschiedenen «Ja» zu antworten.
Zahlreiche weitere Medien – von der «New York Times» («Shingles Vaccine Can Decrease Risk of Dementia») bis zum «British Medical Journal» («Shingles vaccine may help cut dementia risk») – haben sich ebenfalls engagiert. Eine kurze Internetsuche zeigt: Die Meldung wurde weltweit auf unzähligen Portalen weitgehend unkritisch verbreitet. Man fragt sich unweigerlich: Wird hier ein medizinisches Wunder verkauft – oder eine PR-Strategie?

Die wissenschaftliche Basis: Einfaches Studienmodell
Zunächst zur Methodik: Die «Nature»-Studie untersuchte das Auftreten einer Gürtelrose nach Einführung der Impfung 2013 in Wales und verglich das mit den Personen, die im Vorjahr nicht geimpft worden waren. In der geimpften Population sank die Wahrscheinlichkeit, in den nächsten sieben Jahren an Demenz zu erkranken tatsächlich um 3,5 Prozent.
Der «Tagesanzeiger» hatte bereits vor zwei Jahren über die Studie berichtet, als der Vorabdruck (ohne peer-review) öffentlich wurde, und auch dort hiess es im Titel: «Die Gürtelrose-Impfung schützt auch vor Demenz». Wenn ein Review-Prozess fast zwei Jahre dauert, dann sollte man hellhörig werden.
Auf den ersten Blick sieht die Studie solide aus. Doch ein Blick auf den damaligen Vorabdruck der Studie vom 25.5.2023 zeigt: Die Autoren haben ihr Werk deutlich über dem Wert angepriesen, hiess der Titel doch damals: «Causal evidence that herpes zoster vaccination prevents a proportion of dementia cases». Sie behaupteten im Vorabdruck also, dass sie einen kausalen Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Abfall der Demenzdiagnosen gesehen hatten.
Kein Wunder, dass die Gutachter diesen Titel nicht stehen liessen. Der publizierte, nun akzeptierte Titel blieb realistischer: «Ein natürliches Experiment zum Effekt der Zoster Impfung auf die Demenz.» Offenbar mussten die Gutachter hier den Elan der Autoren etwas dämpfen.
Impfstoff nicht mehr verwendet
Ein wichtiges Detail: In der untersuchten Zeit wurde in Wales nicht etwa der heute gebräuchliche Impfstoff Shingrix® verwendet, sondern der inzwischen nicht mehr erhältliche Lebendimpfstoff Zostavax®. Dieser wurde abgelöst, weil er im Vergleich zu Shingrix eine kürzer anhaltende Wirkung zeigte.
Ob und wie die neuen Daten also auf den aktuellen Impfstoff übertragbar sind, kann die zitierte Studie nicht beantworten. In der Berichterstattung wurde aber kaum irgendwo darauf hingewiesen, dass die zitierte Studie gar nicht mit dem bei uns derzeit verwendeten Impfstoff gemacht wurde.
Totimpfstoff ≠ Lebendimpfstoff
Die Unterschiede zwischen den Impfstofftypen sind keineswegs trivial. Lebendimpfstoffe wie Zostavax können sogenannte unspezifische Effekte auf das Immunsystem haben, also Effekte, die über den eigentlichen Infektionsschutz hinausgehen – etwa eine veränderte Anfälligkeit für andere Erkrankungen. Die dänische Forscherin Christine Benn hat diese Phänomene detailliert untersucht.
Totimpfstoffe wie Shingrix® zeigen solche unspezifischen Effekte nicht in gleicher Weise – teils zeigen sie sogar nachteilige Effekte. Die unspezifischen Effekte eines Totimpfstoffs können also nicht einfach mit jenen eines Lebendimpfstoffs gleichgesetzt werden.
Dazu kommt beim heutigen Impfstoff ein relativ neues Adjuvans (AS01b), das in liposomalen Nanopartikeln verabreicht wird – ein innovatives System, zu dessen Langzeittoxizität bislang kaum Daten vorliegen.
Nebenwirkungen? Reden wir später darüber.
Neue Impfstoffe wie auch Medikamente werden gern als «gut verträglich» beworben, so auch Shingrix. Es ist durchaus möglich, dass sich der Impfstoff auch noch in einigen Jahren als «gut verträglich» präsentiert. Doch die Geschichte warnt uns: Seltene, schwere Nebenwirkungen treten oft erst Jahre nach Marktzulassung zutage. Vorsicht ist also keine übertriebene Impfskepsis, sondern wissenschaftlich gebotene Zurückhaltung.
Auch klinische Details werfen Fragen auf: Die Zulassungsstudien schlossen Personen mit früherer Gürtelrose aus – ebenso Menschen mit Allergien oder immunologischen Grunderkrankungen. Ob und wie sicher die Impfung in diesen Gruppen wirkt, ist nicht bekannt.
Ist der neue Wirkstoff sogar noch wirksamer?
Zeigt sich denn beim derzeit gebräuchlichen Impfstoff Shingrix® ein Zusammenhang mit Demenzerkrankungen? Dazu gab es bereits 2024 eine Veröffentlichung in «Nature Medicine».
Die Autoren machten einen ähnlichen Vergleich wie damals in Wales – und fanden, dass die Demenzerkrankungen nach Einführung von Shingrix® sogar noch stärker zurückgingen als dies bei der Einführung von Zostavax® 2013 in Wales der Fall war. Es ist also gut möglich, dass wir es hier wirklich mit einem Effekt der Gürtelrose-Impfung auf das Auftreten von Demenz zu tun haben. Es könnte aber immer noch sein, dass diese Beobachtung keinen kausalen Zusammenhang hat.
Fundierte Analyse notwendig
Um einen solchen kausalen Zusammenhang wahrscheinlicher zu machen, muss man zahlreiche Gegenhypothesen prüfen, die in den genannten Studien nicht untersucht wurden. So zum Beispiel auch den healthy-vaccinee bias, eine Verzerrung von Resultaten durch die Tatsache, dass sich eher gesunde Menschen impfen lassen (gut erklärt auf Infosperber). Auch sollte man untersuchen, ob Demenz häufiger diagnostiziert wurde. Auch dies könnte einen Effekt erklären.
Auch methodische Fehler oder gar Tricks können irreführende Resultate hervorrufen. So wurde zum Beispiel in der 2024 in «Nature Medicine» veröffentlichten Studie eine statistische Methode (RTML-Ratio) verwendet, welche nicht häufig eingesetzt wird. Diese Methode setzt voraus, dass die Beobachtungsdauer a priori festgelegt wird. Das Problem dabei ist, dass man durch einfaches Pröbeln ein statistisches Resultat erhalten kann. Damit soll den Autoren hier nicht ein unlauteres Vorgehen unterstellt werden, aber wenn wie hier einer der Autoren für GSK, den Hersteller von Shingrix®, arbeitet, ist kritische Transparenz umso wichtiger.
Vertrauen in die Impfung: ein empfindliches Gut
Wir leben in einer Zeit, in der das Vertrauen in Impfungen fragiler ist denn je. Die teils übertriebene, unklare oder gar irreführende Kommunikation zur Covid-Impfung hat Spuren hinterlassen. Die Zunahme von Masernfällen in ehemals nahezu masernfreien Regionen ist ein sichtbares Ergebnis dieser Entwicklung.
Gerade deshalb braucht es heute mehr denn je:
- Kritische Medien, die PR von Wissenschaft unterscheiden können
- Wissenschaftler:innen, die Interessenskonflikte transparent machen
- Medizinische Fachpersonen, die nicht jede Impfhoffnung unhinterfragt übernehmen.
Denn jede Übertreibung in der Kommunikation – selbst wenn sie gut gemeint ist – untergräbt am Ende das, was wir eigentlich schützen wollen: Vertrauen.

Fazit
Die Gürtelrose-Impfung ist medizinisch sinnvoll – zur Vorbeugung gegen Gürtelrose. Sie ist wirksam und gut untersucht für genau diesen Zweck. Doch derzeit entsteht der Eindruck, als würde massiv Öffentlichkeitsarbeit für einen zusätzlichen Nutzen betrieben, der wissenschaftlich nicht belegt, sondern nur statistisch assoziiert ist.
Der Unterschied zwischen Schutz gegen Gürtelrose und Schutz gegen Demenz ist in den Schlagzeilen kaum sichtbar – inhaltlich jedoch gewaltig. Wer diese Grenze verschwimmen lässt, gefährdet am Ende nicht nur die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft, sondern das Vertrauen in Impfungen generell.
Und das wäre ein echtes Problem – nicht nur für unser Gedächtnis.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.







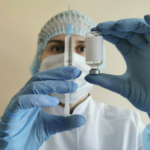



Ihre Meinung
Lade Eingabefeld...