Herzalarm – die Sekunden verglühen
Red.– Der Autor Rainer Jund ist Hals-Nasen-Ohren-Arzt in der Nähe von München und Buchautor. In seinem Buch «Tage in Weiss» *, dessen Titel an ein Gedicht von Ingeborg Bachmann erinnert, schildert er Situationen im Spital – ungeschönt. Alles ist fiktiv, aber es könnte sich genau so zugetragen haben. Infosperber veröffentlicht drei leicht gekürzte Kapitel aus dem Buch.
Ich wollte am Kopf bleiben, am Zentrum. Und ging nach meiner Zeit in der neurochirurgischen Abteilung an die Kopf-Hals-Klinik. An einem schönen Tag war ich länger geblieben, bis mich die Schwester auf der Station zu einer Patientin rief.
Als ich in das Krankenzimmer gerannt kam, war das mittlere Bett leer. Am Fenster stand eine Patientin im Jogginganzug, die Hände seltsam vor der Brust verschränkt, vibrierend. Im Bett an der Tür döste eine Frau, deren Perücke im Liegen verrutscht war. Aus dem Bad hörte ich den voll aufgedrehten Wasserhahn rauschen. Ich riss die gewichtslose Tür auf. Eine Frau auf einem Hocker klammerte sich an das Waschbecken wie an einen Rettungsring. Die Keramik mit dunklen Flecken besprüht. Alle drei Sekunden spuckte sie einen Esslöffel hellrotes Blut in den Wasserstrahl. Sie registrierte mich nicht. Im Spiegel über dem Becken konnte ich kurz ihr Gesicht erkennen, das sehr konzentriert wirkte. Sie spuckte wieder aus.
Die Frau begann zu ersticken
Es war nicht schwer zu verstehen, was passiert war. Vor einigen Tagen war sie im Rachen operiert worden, eine gutartige Vergrösserung des Zungengrundes wurde verkleinert. Hinten im Rachen, wo die Zunge ihre Wurzel hat. Direkt über dem Kehldeckel, dem Eingang in die Luftröhre. Da musste ein Blutgefäss aufgegangen sein. Es musste gar nicht gross sein, konnte der Frau aber direkt in die Atemwege bluten. Nicht stark, nur gerade so viel, dass sie es nicht mehr abhusten konnte. Blut gerinnt auch in der Luftröhre. Sie begann zu ersticken. An ihrem eigenen Blut.
«Machen Sie bitte den Mund auf», schrie ich.
Sie sah mich an. Schien teilnahmslos. Keine Panik. Weit gestellte Pupillen durch das Adrenalin. Sie sah einfach nur hilflos aus, verwirrt.
«Mmhmh.»
Ein blutiger Klumpen auf meiner Hose. Hinter mir ein Schrei, ich drehte mich um, die Bettnachbarin stand in der Tür, hielt sich die Hände an die Wangen und schrie. Die Lampe über dem Spiegel surrte mürrisch.
Die Frau am Waschbecken blutete weiter aus dem Mund, ich stand neben ihr. Auf ihrem hellblauen Blumennachthemd oszillierte ein ganzes Sonnensystem roter Punkte. Sie klatschte mit ihrer Hand auf den Rand des Beckens. Der Wasserstrahl schäumte. Sie trommelte. Ich riss die Tür zum Stationsgang auf und schrie nach der Schwester.
Sekunden, die zur Ewigkeit werden
«Den Herzalarm. Schnell.» – «Wa r u m ?»
«Schnell, den Herzalarm.»
Die Frau wurde bleich im Gesicht. Das kalte Wasser spülte das Blut nicht mehr weg. Bizarre tiefrote Figuren schillerten auf weissem Grund. Die Frau kippte vom Hocker. Ich griff ihr unter die Arme und schleifte sie aus dem Bad. Legte sie auf den Boden in die Mitte des Zimmers. Sie liess Urin und Stuhl unter sich zurück.
Atmete nicht mehr.
Sie atmete nicht mehr.
Ihre Augen standen halb offen.
Ich öffnete ihren Mund, wischte Blutklumpen heraus.
Sauger. Intubieren. Schnell. Schnell!
Wenn Zeit eine lebensbedrohliche Grösse wird, werden Sekunden zur Ewigkeit. Sekunden, die sonst vergehen, schnell, zu schnell, ohne dass wir es bemerken.
Ich wartete und wischte. Sie atmete nicht mehr.
Minuten, Stunden, vor dem Fernseher arglos, massenhaft vergeudet. Tagträumend. Zeitgleich, an anderer Stelle, zählt jede Sekunde. Wenn das Gehirn bei Zimmertemperatur keinen Sauerstoff mehr bekommt, wenn man nicht mehr atmet, dann beginnt es zu sterben. Nach zwei Minuten. Nicht viel Zeit, in der das Leben aus einem Menschen flüchtet, geräuschlos und unbemerkt.
Intubation und Herzdruckmassage
Die Tür wurde aufgeschlagen. Der Herzalarm. Ein Anästhesist, eine Schwester. Beide mit einem roten Notfallrucksack. Sie stiessen Stakkatosätze aus.
«Intubieren.»
«Sauger!»
Eine Sekunde verglühte.
«Saugen, schnell.»
Ein kleiner Sauger wurde ins Zimmer gefahren. Sie versuchten, den Mund frei zu machen. Grosse, braun-rote Klumpen. Mit dem Finger ausgeräumt.
«Laryngoskop. 6,5er-Tubus!»
Intubation, endlich konnten wir anfangen. Der Anästhesist ging mit dem Laryngoskop in den Rachen, an seiner Spitze sitzt ein kleines Lämpchen. Er zog es wieder raus, das Lämpchen blutverschmiert.
«Saugen.»
Wieder rein.
«Ich seh nichts. Ich seh nichts.»
«Saugen.»
Das Lämpchen abwischen. Die Schwester reichte einen neuen Tubus.
Zwei Minuten vergehen schnell. Verlöschen restlos, unaufhaltsam. «Bin drin.»
Wir versuchten zu beatmen. Hörten die Lunge ab. Wir hörten nur das Brodeln des Blutes in ihrer Lunge. Einer begann mit der Herzdruckmassage. Der Nachtrock der Frau war einmal blau, mit Blumen. Jetzt hatten alle rote Tupfer bekommen. Die Blüten flatterten im Rhythmus der Druckmassage.
Der Bauch blähte sich auf. Wir hörten noch mal ab. Wir hatten in den Magen beatmet, nicht in die Lunge.
Nicht lange zwar, aber die Zeit quoll einfach weiter aus ihrem Körper heraus, von Anfang an gegen uns. Den Tubus ziehen. Sauber wischen. Wieder absaugen. Wieder intubieren. Jetzt richtig. Abhören.
Blutstillung mit zwei Fäden
«Ich glaub, wir sind drin.»
Beatmen. Drücken. Drücken.
Wir fuhren los, in den OP. Eine Anästhesieschwester sass rittlings auf dem Bett und drückte hundertmal in der Minute auf den Brustkorb der Patientin.
Während ich mich umzog, überlegte ich, was wir tun sollten. Die Blutungsquelle sichern. Den Blutfluss stoppen, aufhalten. Während die Anästhesisten den Kreislauf stabilisieren. Wenn es noch einen Kreislauf gibt.
Im OP: ein regelmässiges Geräusch. Der Puls. Das war gut. Ich schlüpfte in die Handschuhe. Mit einem Rohr, in dem ein starkes Licht untergebracht ist, untersuchte ich Rachen und Schlund der Frau. Am Zungengrund ragte ein kleines, halmartiges Gefäss aus der Schleimhaut. Auf ihm thronte ein kleiner Blutstropfen. Es spritzte nicht. Nicht mehr. Mittlerweile mussten sich Blutgerinnsel im Gefäss gebildet haben, die es verschlossen hielten. Das war nur möglich, weil sie keinen Blutdruck mehr hatte.
Ich legte einen Faden um das Gefäss und zog ihn zu einem Knoten. Und noch einen. An einem Faden hing das Leben sowieso.
Sie kam auf die Intensivstation. Sie war hirntot. Wurde beatmet.
Ihr Ehemann bedankte sich
Ich besuchte die Frau. Auf dem Nachttisch Kinderfotos und ein Katzenbild. Ihr ganzes Leben.
Einige Tage später stellte sich heraus, dass sie nach ihrer ursprünglichen Operation durch eine Infusionsnadel eine kleine Venenentzündung bekommen hatte. Sie wurde deshalb mit Heparin versorgt, damit sich keine Blutgerinnsel bilden konnten.
Der Stationsassistenzarzt hatte ihr viel zu viel Heparin gegeben. Das setzte die Gerinnungsfähigkeit des Blutes stark herab. Die Prothrombinzeit, die in Sekunden anzeigt, wie schnell das Blut gerinnt, war massiv verlängert. Was normalerweise schnell geht, dauerte jetzt viel zu lange.
Kann aber auch sein, dass das gar nichts mit dem Ereignis zu tun hatte. Nachblutungen gibt es immer wieder. Schicksalhaft.
Der erste Operateur und der Stationsarzt haben die Frau nie wieder gesehen. Und auch nicht auf der Intensivstation besucht. Einige Tage später riefen mich die Angehörigen an. Ihr Mann bedankte sich am Telefon. Aufrichtig. Hoffnung schwelte in seiner Stimme. Oder Unwissen. Ich wusste nicht, was ich hätte anders machen sollen.
Ich konnte ihr nicht schnell genug helfen. Hilfe.
_____________________
* Rainer Jund: «Tage in Weiss». Piper Verlag 2019, ca. 14 bis 29 Franken bzw. 12 Euro, je nach Buchhändler.
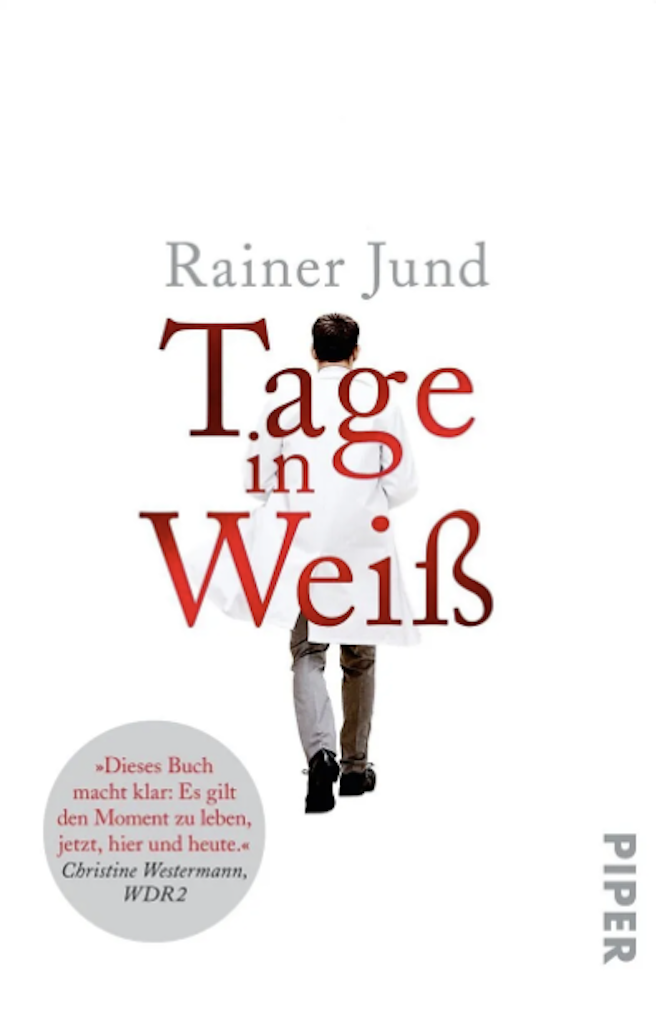
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.











