Geschlechtsumwandlung: Erschreckend wenig gesichertes Wissen
Wissenschaftlerinnen der britischen Universität York haben 23 Leitlinien aus verschiedenen Ländern zum Thema Geschlechtsdysphorie bei Kindern und Jugendlichen untersucht. Ihre in den «Archives of Disease in Childhood» veröffentlichten Befunde sind erschreckend.
Denn die Qualität dieser Leitlinien lässt zu wünschen übrig – obwohl sie seit langem als Grundlage für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen dienen, welche ihr biologisches Geschlecht ablehnen. Diese Leitlinien würden gegen die internationalen Standards verstossen, wie Leitlinien entwickelt werden sollten, berichtet das «British Medical Journal» (BMJ).
Das Wissen zum Einsatz von Pubertätsblockern und Hormonen bei jungen Menschen mit geschlechtsspezifischen Problemen sei «völlig unzureichend gewesen, so dass es unmöglich war, ihre Wirksamkeit oder ihre Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit zu beurteilen», fasst das «BMJ» die Ergebnisse zusammen. Es fehlten auch Daten zu den langfristigen Folgen, beispielsweise mit Pubertätsblockern. Diese sollen das Wachstum von Geschlechtsorganen stoppen. Im nächsten Schritt sollen dann Geschlechtshormone des angestrebten Geschlechts zur Verweiblichung oder Vermännlichung beitragen.
«Ich kenne kein anderes Gebiet der Kinderkrankenpflege, in dem wir jungen Menschen eine potenziell irreversible Behandlung zukommen lassen und keine Ahnung haben, was mit ihnen im Erwachsenenalter geschieht.»
Hilary Cass, Leiterin der Untersuchung der «Gender Identity Services» für Kinder und junge Menschen in Grossbritannien
Dürftige Beweislage
Für Nutzen und Risiken der medizinischen geschlechtsangleichenden Behandlungen gebe es nicht genügend Belege. Obwohl die meisten Leitlinien zur Genderdysphorie zwar darauf hinweisen würden, zitierten viele Leitlinien genau diese unzureichenden Belege, um medizinische Behandlungen zu empfehlen.
Medizinische Leitlinien
Müdigkeit, Halsschmerzen, Herzinfarkt, Durchführung von Allergietests – zu allen möglichen medizinischen Themen erstellen Fachleute sogenannte Leitlinien für Ärztinnen und Ärzte. Darin wird der aktuelle Stand des Wissens systematisch und strukturiert zusammengefasst. Qualitativ gute Studien erhalten dabei mehr Gewicht als solche mit geringer Aussagekraft. Je nachdem, wie gut der Nutzen einer Behandlung bewiesen ist, leiten sich daraus starke oder schwache Empfehlungen für diese Therapie ab.
«Ich kenne kein anderes Gebiet der Kinderkrankenpflege, in dem wir jungen Menschen eine potenziell irreversible Behandlung zukommen lassen und keine Ahnung haben, was mit ihnen im Erwachsenenalter geschieht», sagte Hilary Cass, die frühere Präsidentin des «Royal College of Paediatrics and Child Health» in einem Interview mit dem «British Medical Journal». Hilary Cass leitete eine unabhängige Untersuchung zu Anlaufstellen für betroffene Kinder und Jugendliche, sogenannte «Gender Identity Services», in Grossbritannien. Diese befasste sich unter anderem mit der in die Kritik geratenen «Tavistock»-Klinik in London, welche sich auf Behandlungen von Heranwachsenden mit Geschlechtsdydsphorie spezialisierte. In einem von Cass verfassten Artikel im «British Medical Journal» fordert die Kinderärztin: «Diese jungen Menschen sollten keine schlechtere Betreuung erhalten als andere Jugendliche in ähnlicher Notlage.»
Die Beweislage bei den Pubertätsblockern sei Cass zufolge «sehr dürftig». «Eines der Probleme besteht darin, dass die Angehörigen der Gesundheitsberufe nicht genau wissen, warum sie diese Medikamente verabreichen.» Die Leitlinie der «World Professional Association for Transgender Health» empfehle die Hormonblocker, ohne dass dies wissenschaftlich abgestützt sei.
Eine internationale Leitlinie beeinflusste fast alle anderen
Diese Leitlinie hat die internationale Behandlungspraxis von Kindern und Jugendlichen mit Gendersdysphorie stark bestimmt. Bis auf zwei Leitlinien – die schwedische und die finnische – seien alle anderen Leitlinien massgeblich durch die Leitlinie der World Professional Association of Transgender Health (WPATH) von 2012 beeinflusst worden – obwohl es ihr an Transparenz und stringentem Vorgehen bei der Erstellung gefehlt habe. Die international praktizierte Behandlung dieser Kinder und Jugendlichen hatte also jahrzehntelang keine wissenschaftlich fundierte Basis.
Von den 23 Leitlinien legten nur die schwedische und die finnische offen, wie sie zu ihren Empfehlungen kamen. Diese beiden Leitlinien seien laut dem «BMJ» evidenz-basiert, sie würden sich also auf die vorhandenen Belege abstützen. Beide raten zu einem vorsichtigeren Einsatz von Pubertätsblockern.
Neue Leitlinie für die Schweiz
Gegenwärtig entwickeln Fachleute eine Leitlinie «Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie im Kindes- und Jugendalter» für den deutschsprachigen Raum. Sie wird demnächst fertig gestellt und für Deutschland, Österreich und die Schweiz gelten. Laut dem «Deutschen Ärzteblatt» positioniere sie sich im Vergleich zu nationalen Empfehlungen in den Ländern Schweden, Finnland sowie des nationalen Gesundheitsdiensts in England als «weniger restriktiv beim Einsatz von Pubertätsblockern und geschlechtsangleichenden Hormonbehandlungen».
Der britische nationale Gesundheitsdienst erlaubt die Verordnung solcher Medikamente bei Jugendlichen seit kurzem ausschliesslich im Rahmen von Studien. In Schweden haben laut dem «Deutschen Ärzteblatt» zwei autonome staatliche Stellen empfohlen, Pubertätsblocker, Hormone oder geschlechtsangleichende Operationen vor dem 18. Lebensjahr nur noch im Rahmen von klinischen Studien einzusetzen beziehungsweise durchzuführen.
Bloss bei einer kleinen Anzahl von Menschen Hinweise auf einen Nutzen
Die Pubertätsblocker wurden beispielsweise an der Londoner «Tavistock»-Klinik ab 2014 routinemässig eingesetzt – auf welcher wissenschaftlichen Basis dies erfolgte, war jedoch völlig unklar. Ebenso unklar blieb, ob solche grundlegenden Behandlungen unbeabsichtigte und unerkannte Konsequenzen hatten. Den deutlichsten Hinweis für einen Nutzen habe es laut Hilary Cass nur bei einer kleinen Anzahl von männlich geborenen Menschen gegeben, die ihre Geschlechtsidentität vom frühen Kindesalter bis ins Erwachsenenalter hinein in Frage stellten. Abgesehen von dieser Gruppe, gebe es keine Beweise für den Nutzen von Pubertätsblockern bei Jugendlichen.
In den frühen 2000er-Jahren sei die «Tavistock»-Klinik von wenigen jungen Männern aufgesucht worden, die ihr biologisches Geschlecht in Frage stellten, berichtet das «BMJ». Bis 2014 habe sich dies stark verändert: Nun erschienen dort reihenweise junge Mädchen mit Genderdysphorie. Viele davon litten an weiteren Problemen wie Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, schlimmen Kindheitserfahrungen, ADHS oder Autismus.
Laut Cass definiere sich aktuell die am stärksten wachsende Trans-Gruppe als «nicht binär». Hilary Cass stellt fest: «Es gibt fast keine Forschung über diese Gruppe, von der viele ein Spektrum von Behandlungen wünschen, die nicht auf eine vollständige medizinische Umstellung hinauslaufen. […] Medikamente sind binär, aber das Geschlechtsempfinden ist es oft nicht.»
Zu den Auswirkungen ist viel zu wenig bekannt
Pubertätsblocker würden den Heranwachsenden häufig mit dem Argument verschrieben, dass sie damit «Zeit gewinnen», um sich klar zu werden, wie es weitergehen solle. Allerdings gebe es keinen Beweis, dass sie diesen Anspruch erfüllten, so Cass. Denn in Grossbritannien erhielten im Nachgang fast alle Patient*innen anschliessend weibliche oder männliche Geschlechtshormone, um ihren Körper an das gewünschte Geschlecht anzunähern. Die Pubertätsblocker waren folglich der Auftakt der Behandlung.
Auch beim Einsatz von feminisierend oder maskulinisierend wirkenden Hormonen vor dem 18. Geburtstag gebe es viele Fragezeichen und keine Beweise. Es fehle an Langzeitstudien, insbesondere bei den Mädchen, die nebst der Geschlechtsdysphorie psychische Erkrankungen hätten.
Die Erkenntnisse über den Einsatz von Pubertätsblockern und Hormonen bei jungen Menschen mit geschlechtsspezifischen Problemen sind laut dem «British Medical Journal» «völlig unzureichend». Es sei daher unmöglich, ihre Wirksamkeit oder ihre Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit der Jugendlichen zu beurteilen. Es könnten auch weder Schlüsse zu den Auswirkungen auf die Geschlechtsdysphorie gezogen werden, noch zu den Folgen für die psychische und psychosoziale Gesundheit, für die geistige Entwicklung der damit behandelten Heranwachsenden, für die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper, die Fortpflanzungsfähigkeit, die Knochendichte oder zu den Auswirkungen auf das Herz.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.







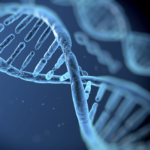


Danke Martina Frei für den wichtigen Artikel. Dass Menschen mit Geschlechtsdysphorie endlich ernst genommen werden: super! Doch dass die Behandlungen auf dürftigem medizinischem Wissen beruht – das geht gar nicht. Wir brauchen dringend mehr Studien/Informationen, um diese sonst schon schwierige Situation auf längere Zeit nicht zu verschlechtern. Mir scheint generell, dass in der klassischen Medizin zunehmend grundlegende Werte in der Medizinethik (In erster Linie nicht schaden, Autonomie, Menschenwürde) zu kurz kommen.
Eine gute Information zu den Therapien bei «Geschlechtsinkongruenz» ist nachzulesen im frei zugänglichen Artikel «Geschlechtsinkongruenz – Definition, Diagnosestellung und Transitionsoptionen» von Antje Feicke und Barbara Mijuskovic.
Apropos Studien zu Geschlechtsumwandlungen: Wie kann ein ethisch verantwortbares Studiendesign konstruiert werden, solange kein gesichertes Wissen darüber existiert? Tierversuche können keine geeignete Grundlage dafür bilden, da eine «Geschlechtsdysphorie» selbst bei nächsten Verwandten (Bonobos oder Schimpansen) kaum beschreibbar ist… Eine Auswertung der bereits erfolgten Behandlungen würde genaue Protokolle der individuellen Dysphorien und der vorgenommenen «Therapien» und die genaue Beschreibung der körperlichen und psychischen Folgen / Resultate voraussetzen. Seriös auswertbares Material dafür ist vermutlich kaum vorhanden. Menschenversuche? Könnten höchstens an gewisse Praktiken in der Nazizeit erinnern…
Bevor man über Wirksamkeit oder Nutzen reden kann, muss man definieren, woraus oder worin diese bestehen, wo und bei wem diese eintreten, wer betroffen davon ist und wer das beurteilen kann oder darf. Mir scheint, hier massen sich etliche Akteure aus Politik, Medien und Gesellschaft Kompetenzen an, welche sie nicht haben und ihnen auch nicht zustehen. Meiner Meinung nach muss man von den Interessen des Patienten und den Nutzen für diesen ausgehen. Allerdings scheint es meist darum zu gehen, was andere, nicht Betroffene, davon halten und wie sie sich dabei fühlen, wenn das Selbstverständnis ihrer Weltsicht ins Wanken gerät.
Das Geschäft kommt hier ganz weit vor der Moral. Ich wundere mich gar nicht darüber, dass ohne Wissen über die Folgen einfach drauflos «therapiert» wird. Ich möchte gerne wissen, was solche «Behandlungen» kosten. Ähnliches geschieht auch bei Frauen, denen das Hymen («Jungfernhäutchen») wiederhergestellt wird – für sage und schreibe 10’000 bis über 20’000 Fr. Dabei werden sie nicht einmal seriös aufgeklärt. (Quelle: ein Tagi-Magazin vom letzten Jahr). Immerhin: hier dürften die gesundheitlichen und psychischen Folgen eher minimal sein…
Es soll ja homöopathische Kügelchen geben, deren angebliche Wirkung wissenschaftlich nicht nachgewiesen, das also nicht evidenzbasiert ist. Großes Geschrei, dass das die Krankenkassen bezahlen. Nun, es gibt immer Neuland, das betreten werden muss und wo es Betretungswillige gibt, die nicht warten, bis andere vor ihnen probieren. Wir leben immer in einer Zeit, wo das Leben lebensgefährlich ist.