Kommentar
Warum ich keine Historien-Dramen mehr vertrage
Wer die Kriminalromane von Leonardo Padura liest, kann etwas erfahren über Polizei und Kriminalität in Havanna in den Krisenjahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Denn Padura ist Kubaner, er lebt in Kuba, er zeichnet – wenn auch nur reflektiert in der Figur von Kommissar Mario Conde – ein Bild von dem seit 1959 dauernden Experiment, auf der Karibikinsel Sozialismus zu praktizieren. Wenn derselbe Padura dann einen historischen Roman über Leo Trotzki schreibt («Der Mann, der die Hunde liebte»), interessiert mich das weniger. Denn ich weiss, dass Padura – selbst mit vielen Recherchen und grossem Einfühlungsvermögen – nicht das Leben einer jüdischen Bauernfamilie in der Ukraine in der Zeit ab 1879 nacherleben wird. Wenn ich etwas Authentisches über die Kindheit und das Leben des Lew Dawidowitsch Bronstein, den sie Trotzki nannten, erfahren wollte, dann würde ich vielleicht seine Autobiographie lesen, nicht aber Leonardo Padura.
Selbstverständlich ist das meine persönliche Option, und es liegt mir fern, historische Romane in Bezug auf ihre stilistische Kunst oder die Darstellung universaler menschlicher Probleme beurteilen zu wollen. Umberto Eco zum Beispiel hat in «Der Name der Rose» sicher brillant illustriert, wie die katholische Kirche im Spätmittelalter die philosophischen Überlieferungen der Antike materiell auszulöschen versuchte, um die herrschende Ideologie zu verteidigen. Und von Conrad Ferdinand Meyers «Jürg Jenatsch» kann man wohl einiges über Graubünden und die europäische Geschichte des 17. Jahrhunderts lernen.
Von persönlicher Erfahrung geprägte Fiktion
Mich treibt aber die Neugier, etwas über konkrete gesellschaftliche Realitäten zu erfahren, und zwar von Zeitzeugen. Und in dieser Hinsicht lässt sich nicht abstreiten, dass literarische Fiktion umso vertrauenswürdiger ist, je näher die beschriebene Zeit an der Lebenszeit der Autorin oder des Autors liegt.
Es geht um dokumentarische Substanz in der Fiktion. Ich habe zum Beispiel in keiner politischen Abhandlung so viel über die Ursprünge des Vietnamkrieges gelernt wie in Graham Greenes Roman «The quiet American». Sein Buch ist Fiktion, aber eine von persönlicher Erfahrung gezeichnete Fiktion, denn Greene hatte in Vietnam gelebt und erfasste meisterhaft die politische Realität der 50er und 60er Jahre. Dass er ins Schwarze getroffen hatte, zeigte sich, als sein Roman verfilmt werden sollte. Der amerikanische Geheimdienst CIA intervenierte in Hollywood, um das Drehbuch zu ändern. Die USA sollten nicht als die «bad guys» in dem Stück erscheinen. Greene stand danach zeitlebens als politisch unzuverlässiges Subjekt unter Beobachtung des FBI.
«Du duftest wie die süsseste Mairose»
Die Unterhaltungsindustrie produziert unaufhörlich Spielfilme und Serien über historische Figuren. Viele dieser Filme zeigen grossartige Bilder, sind perfekt, was Kamera und Montage angeht. Oft haben auch die Autorinnen und Autoren zur Historie recherchiert. Ich ertrage es aber nicht, wenn ich Martin Luther und die Strassenjungen in Wittenberg in bestem Hannoveraner Hochdeutsch unserer Tage reden höre. Sie haben so nicht geredet. Und es langweilt mich, wenn ich Historienfilme sehe, die mit den Love Stories der Rosamunde-Pilcher-Dramaturgie gestrickt sind.
Diese Filme erschlagen uns meist mit Action, mit dem fotografischen Hammer der Monumental-Szenen. Mehr hochauflösender Realismus geht nicht: Blut, Dreck und Schlachtengetümmel. Dagegen kommt die Sprache der Protagonisten oft auf pathetischen Stelzen daher, als spielte man ein Theaterstück von Friedrich Schiller. Da spricht ein Kreuzritter im 11. Jahrhundert: «Du duftest wie die süsseste Mairose.» Oder es sagt einer: «Wenn ich mein Leben opfern soll, dann tue ich es mit Freude.» Sprache und Bild passen zusammen wie Hip-Hop und Breakdance zum gregorianischen Choral.
Das Publikum stört sich nicht an diesen Widersprüchen. Man will ja nur unterhalten werden. Und sonst nichts. Dabei verschwinden oft die Grenzen zwischen Historienfilm, Fantasy und Science Fiction. Ob Spartakus-Aufstand, «Herr der Ringe» oder «Outlander», es ist alles die gleiche Bildersuppe.
«Nachgestellte Szenen»
Auch die Unart, Dokumentarfilme mehr und mehr mit gespielten Szenen zu «illustrieren», weckt grosse Zweifel an dem, was da vermittelt wird. Wenn ein Gespräch zwischen Hitler und Chamberlain geschauspielert wird, warum sollte man dann einem Claas Relotius vorwerfen, dass er ein Interview mit zwei Jungen im syrischen Bürgerkrieg erfindet? Wo hört das Dokumentarische auf, und wo fängt die Fälschung an? Bisweilen kommt mir – mit einigem Grauen – die Vorstellung, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in unserer Mediengesellschaft nicht mehr anders wahrgenommen würden als in den «nachgestellten Szenen» einer Mainstream-Ästhetik. Es kommt einem vor, wie wenn eine Gesellschaft, die orientierungslos im Nebel der Fake News herumstolpert, nach Fixpunkten sucht, die handfeste Wahrheiten bieten. Man findet sie problemlos in einer Vergangenheit, in der die Guten noch gut und die Bösen noch richtig böse waren.
Schwert-Helden im Pelzmantel
Da wird ein «Mittelalter» gespielt, in dem Historie reduziert wird auf die Leidenschaften grosser Schwertträger in Pelzmänteln und ihrer schönen Frauen. Da ist die Gesellschaft, ihre Kultur und Ökonomie so einfach strukturiert wie in drittklassigen Far-West-Filmen.
Peter Dinklage, einer der Schauspieler der Kultserie «Game of Thrones», sagt in einem Interview: «Niemand konnte ahnen, wie sehr die Serie den Zeitgeist treffen würde.»
Nie war das Bedürfnis nach Aliens, Zombies, Vampiren, Kobolden, Drachen, Zauberern und Schwert-Helden so gross wie in unserer 3-D-Drucker-Epoche, in der die Versicherungen «Sorglos-Pakete» anbieten und unser Kühlschrank so programmiert ist, dass er in Eigenverantwortung Joghurt nachbestellt. Je mehr die Welt zum «intelligenten Haus» wird, zum unentrinnbaren Fertigprogramm, umso grösser wird die kompensatorische Sehnsucht nach dem «Wilden», nach dem Ausbruch in Traumwelten und nach der virtuellen Fahrt ins Herz der Finsternis.
«Es kann hohl klingen»
Keine Autorin, kein Autor kann glaubwürdig über alltägliche Dinge schreiben, die er oder sie nicht selbst kennt. Die britische Schriftstellerin Zadie Smith sagt auf die Frage nach Authentizität: «Schreiben ist der grosse Freiraum des Möglichen. Aber es kann hohl klingen, wenn man über Dinge schreibt, die gar nichts mit der eigenen Erfahrung zu tun haben.» («Tagesanzeiger», 13. Okt. 2017)
Wahrscheinlich hat Agatha Christie keinen Mord im Orientexpress erlebt, aber sie hat vielleicht davon in der Zeitung gelesen, sie kennt diese Bahnlinie durch den Balkan, und sie kennt ihre eigene soziale Umgebung, die Politik und die britische Gesellschaft ihrer Epoche (und deren Vergnügen an Detektiv-Arbeit als einer Art von Kreuzworträtsel).
Wenn Autorinnen und Autoren aber den Versuch machen, sich in Figuren weit zurückliegender Epochen «einzufühlen», kann das nur schief gehen. Besser gesagt, was dabei herauskommt, ist zwangsläufig die Projektion eigener Normen und Wertvorstellungen auf Ereignisse der Vergangenheit. Die Vergangenheit wird dann zum Kramladen, aus dem sich jeder herausklauben kann, was ins politisch korrekte Setting passt.
Der französische Romancier Eric Vuillard schildert den Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 mit einer radikalen Verve, als marschierte er mit seiner Handykamera in einer Demonstration der Gilets Jaunes. Und er sagt dazu: «Man müsste, wenn das Herz uns aufwühlt, wenn die Ordnung uns erbittert und die Verwirrung uns den Atem nimmt, die Türen unserer lächerlichen Elysée-Paläste eintreten.» («Tagesanzeiger», 9. April 2019)
Treffender könnte er die Sache nicht kommentieren: Sein Roman «14. Juli» transportiert nicht viel mehr als einen trendigen anarchistischen Hype. Rabenschwarz erscheinen die Reichen und strahlend weiss das arme Volk. Im Historiendrama wird die Story in der Regel simplifiziert auf Held und Bösewicht. Und aus den Problemen unserer Zeit wird ein Bild der Vergangenheit interpoliert.
Wenn zum Beispiel der Autor Daniel Kehlmann in einem farbenprächtigen Roman einen Till Eulenspiegel im Dreissigjährigen Krieg imaginiert, kommt eine Rezension zu dem Schluss, die Analogien zur Gegenwart seien mit Händen zu greifen: «Ein Haufen Kinderleichen ruft die Befreiung der KZ herauf. Die Logik des Hexenprozesses die Schautribunale Stalins. Der mörderische Glaubensfanatismus der Jesuiten den Islamischen Staat.» («Tagesanzeiger», 11. Oktober 2017)
Schöne Sandburgen aus Wörtern
Das mögen naheliegende Projektionen sein, mit dem Erkennen gesellschaftlicher Vorgänge in der Vergangenheit haben sie aber nichts zu tun. Literatur ist – in meinem Verständnis – immer Wahrheitsfindung, Enthüllung der Welt. Wenn ich recht erinnere, war es Jean-Paul Sartre, der einmal schrieb, Literatur müsse mehr leisten als nur «schöne Sandburgen aus Wörtern zu bauen». Als sprachliche Schöpfung erweitert Literatur das Verständnis der Welt. Deshalb sollten die Schreibenden die Welt, über die sie schreiben, selbst angeschaut haben, bevor sie uns ihre Weltanschauung nahebringen.
Der Versuchung, die Weltpolitik als «Game of Thrones» darzustellen, erliegen auch manche Medien und ihre Journalisten. «Der Spiegel» schrieb in eigener Sache über die Fälschungen seines Mitarbeiters Claas Relotius: «In solchen Texten zieht sich die Gegenwart einmal auf ein lesbares Format zusammen, grosse Linien der Zeitgeschichte werden fassbar und schlagartig wird das Grosse ganz menschlich verständlich.»
Menschlich verständlich ist das zweifellos, weil der Mensch zur Fälschung neigt, um sich die Welt einfach begreiflich zu machen. Das nennt man Ideologie.
Geschichte erklären ist aber nicht Storytelling für eine Gemeinde von Harry-Potter-Fans. Es ist eine ernste und verantwortungsvolle Aufgabe der Historikerinnen und Historiker. Das gilt besonders für vergangene Jahrhunderte. Ein Johan Huizinga zeigt uns in seinem Klassiker «Herbst des Mittelalters» die Welt des Adels in Burgund und Nordfrankreich im 14. und 15. Jahrhundert, ein Philipp Blom zeigt die wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen des Klimaschocks im 16. Und 17. Jahrhundert, und ein Michael Zeuske beschreibt die Ökonomie der Piraterei und des Sklavenhandels in der Karibik. Sie alle begründen ihre faszinierenden Darstellungen mit einer enormen Fülle von historischen Dokumenten. Kein Hollywood-Historienfilm und kein historischer Roman wird dies jemals leisten können.
Aber gut, man sollte auch nicht fundamentalistisch werden mit der Kritik am Historien-Drama. Mit einer guten Kamera-Performance und dem richtigen Drehbuch können Caesar und Kleopatra im Bett sicher unterhaltsam sein.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine.





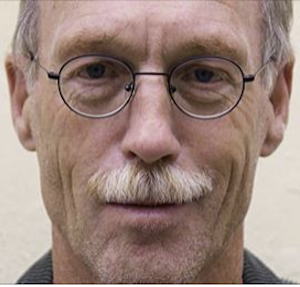



»Sie haben so nicht geredet«, schreibt Helmut Scheben über einen Film, der in der Zeit Luthers spielt, die Strassenjungen aber modernes Hochdeutsch reden. Das ist der eine Anachronismus. Ein weiterer, der sich durch das gesamte US-Filmschaffen hindurchzieht, ist die verquere Darstellung, dass Amerikaner auf der ganzen Welt, wo sie Einheimische ansprechen, problemlos verstanden werden und ihnen selbstverständlich stets auf Englisch geantwortet wird. Dieser amerikanische Sprachimperialismus hat Auswirkungen in der Realität, indem fraglos vorausgesetzt wird, die ganze Welt – und selbstverständlich erst recht der liebe Gott – sprächen Englisch.
Aber auch in deutschen dokumentarischen Produktionen mit geschichtlichem Hintergrund gibt es keine sprachlichen Verständigungsprobleme. Die arme Hugenottenfamilie die 1685 aus Westfrankreich nach Deutschland flüchtet, bittet dort Bauern in perfektem Deutsch um ein Stück Brot und Unterkunft. Im kürzlich auf 3sat ausgestrahlten Dreiteiler »Maximilian« philosophieren der österreichische Thronfolger und seine nachmalige Gemahlin Maria von Burgund schon anlässlich ihrer ersten Begegnung auf höchstem Niveau über die Liebe – auf deutsch. Dabei sprach Maria Zeit ihres Lebens kein Wort Deutsch und Maximilian zu diesem Zeitpunkt kaum mehr als ein paar rudimentäre Brocken Französisch. Das sind ebenso ärgerliche Verzerrungen historischer Tatsachen wie die von Scheben monierten Anpassungen von Filmhandlungen an die Ideologie des Zeitgeists.
"Menschlich verständlich ist das zweifellos, weil der Mensch zur Fälschung neigt, um sich die Welt einfach begreiflich zu machen. Das nennt man Ideologie."
So lange es sich bei der «Fälschung» um historisches handelt, ertrage ich das recht gut, wenn eine oder einer nicht gerade den Holocaust leugnet oder vorgibt, Gottes Willen zu kennen.
Aber wenn der gegenwärtige Mensch wider besseres Wissen redet, nicht um die Welt verständlich zu machen, sondern um sie nach seinem Gusto zu drehen, dann ist das für mich «menschlich nicht verständlich». Es ist dann schlicht gelogen und verlogen.
Beispiele gefragt? Lebende, nicht historische!