Sprachlupe: Flotte Titel setzt, wer Gedanken liest
«In grossen Dingen reicht es, gewollt zu haben.» Halten wir uns ans geflügelte lateinische Wort, so sind uns kurz vor Ostern aus Zeitungstiteln wahre Heldengestalten entgegengetreten, sogar falls sie scheitern sollten. Da will einer «Geschichte schreiben». Und gleich ihrer sieben wollen «Donald Trump besänftigen». Die «Sprachlupe» will dem journalistisch behaupteten Willen auf den Zahn fühlen. Ähnliches hat sie schon vor Jahren bei der verbreiteten Formel versucht, jemand sei von irgendetwas «überzeugt». Es ist vielleicht kein Zufall, dass schon damals das erste Exempel aus dem Eishockey stammte: Im Sportteil wird nicht selten dick aufgetragen, gerade auch mit «Historischem».
Der angehende «Geschichtsschreiber» ist der Schweizer Nino Niederreiter, der für Winnipeg spielt. Ihm wird natürlich nicht die Absicht unterstellt, schreibend unter die Historiker zu gehen, sondern diejenige, etwas zu leisten, das in die Geschichtsbücher gehört. Denn Winnipeg wäre als Gewinner des Stanley Cup die erste kanadische Mannschaft seit 1993, die nordamerikanischer Clubmeister würde. Hat Niederreiter vor der anstehenden Endrunde Siegeswillen geäussert? Aus dem Artikel erfahren wir es nicht, denn da kommt überhaupt keine Äusserung von ihm vor, aber klar: Ein Sportler will immer gewinnen. Dass er mit dem Erfolg «Geschichte schreiben» würde, ist nur die Einschätzung des Sportjournalisten. Und es wäre nicht einmal kanadische Geschichte, sondern bloss «Schweizer Sportgeschichte».
Ansteckend sanftmütiger Bundesrat?
Hat es mit dem siebenfachen Willen zu Grossem mehr auf sich? «Bundesrat will Donald Trump besänftigen», hiess es im Titel eines Berichts darüber, dass ein Entscheid über Schweizer Regeln für grosse Internet-Plattformen vertagt wurde. Hatte die Regierung selber gesagt, warum? Sie hatte nicht einmal gesagt, dass. Erst auf Nachfrage von Tamedia liess sie die Verschiebung bestätigen, ohne Angabe von Gründen. Dass es darum ging, «die USA in dieser heiklen Phase nicht zu verärgern», sollen der Redaktion «mehrere Quellen im Bundeshaus» verraten haben. Gut möglich – aber reicht das schon als Beleg für den magistralen Ehrgeiz, «Trump zu besänftigen»? Gelänge es, generell und auf Dauer, so wäre das wahrlich etwas für die Geschichtsbücher.
Doch leider sind wir hier nur auf dem weiten Feld der journalistischen Zuspitzungen. Dass eine angeblich verratene oder auch nur erratene Absicht als Tatsache daherkommt, entspricht mittlerweile gängiger Medienroutine. Aber sogar dann, wenn sich die Absicht mit einem Zitat belegen lässt, ist die Wiedergabe zuweilen von einer Unterstellung begleitet. Juristen würden sagen, es liege ein Willensmangel vor, weil der Text nicht dem wirklichen Willen entspreche. Letzteren kennt man freilich nie – höchstens das, was die Person, die da möglicherweise etwas will, darüber gesagt hat. Wer das glaubt oder aber meint, dahinter eine andere Absicht zu erkennen, kann eine solche Willensmeldung medial verbreiten. Im Blatt mit dem ambitionierten Gesamtbundesrat liess ein anderer Titel Leichtgläubigkeit vermuten, zu einem bei den Hayeks nicht genehmen Kandidaten für den Verwaltungsrat ihrer Uhrenfirma: «Ein Amerikaner will Swatch-Group helfen». Online stand «auf die Sprünge helfen», aber das hätte die fette Druckzeile gesprengt.
«Will heissen»: Was will denn da?
Ganz gewiss liegt ein Willensmangel vor, wenn der Wille gar keiner (natürlichen oder juristischen) Person zugeschrieben wird, sondern einem Text. Das gilt etwa für die beliebte Einleitung «will heissen» zur Interpretation einer Aussage. Eine ehrlichere Art, die eigene Deutung einzuleiten, wäre «das soll wohl heissen». Auch wer sagt, ein Gesetz «wolle» dies und das erreichen, schreibt nicht dem Gesetz einen Willen zu, sondern dem gesetzgebenden Organ. Da aber kaum jemand meint, das Gesetz selber verfüge über Willenskraft, wird dieses «Wollen» schon richtig verstanden. Dagegen suggeriert bei der Interpretation von Äusserungen «will heissen» eine bestätigte statt nur vermutete Bedeutung. Und das will etwas heissen.
So ein «will heissen» kam auch in der Zeitungsausgabe mit dem Eishockeyaner vor. Es leitete eine Betrachtung über Politiker ein, die ihren Völkern Mühsal zumuten, aber mit der Verheissung einer glänzenden Zukunft – wie gerade eben Trump mit seiner «wirtschaftlichen Revolution», die ein «historisches Resultat» zeitigen werde. Das lateinische «per aspera ad astra» (durchs Stürmische zu den Sternen) kam im Artikel nicht vor, wohl aber Churchills angebliches «Blut, Schweiss und Tränen». Diese umgedrehte und unvollständige Übersetzung ist schon so oft zitiert worden, dass sie so etwas wie falsche Echtheit erlangt hat. Der britische Premier aber sagte 1940: «I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.» Verheissen hat er damals übrigens gar nichts, nur den Sieg als Ziel verkündet. Das auf Deutsch meist weggelassene «toil» ist schwierig zu übersetzen, «Mühsal» eher zu schwach und passiv. Gut würde unser mundartlicher «Chrampf» passen. Auch saubere Medienarbeit ist einer.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.





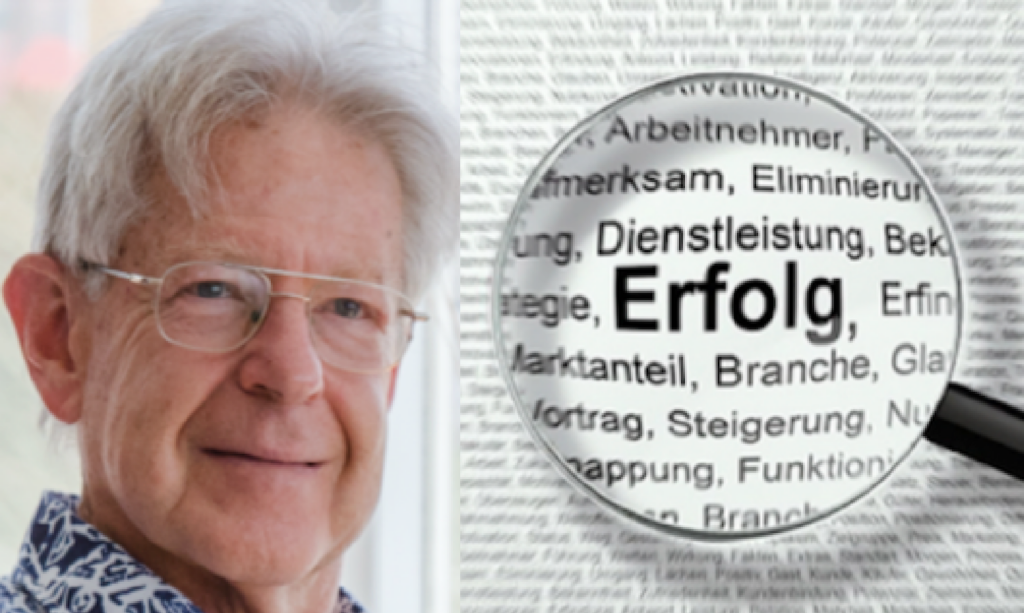




Ihre Meinung
Lade Eingabefeld...