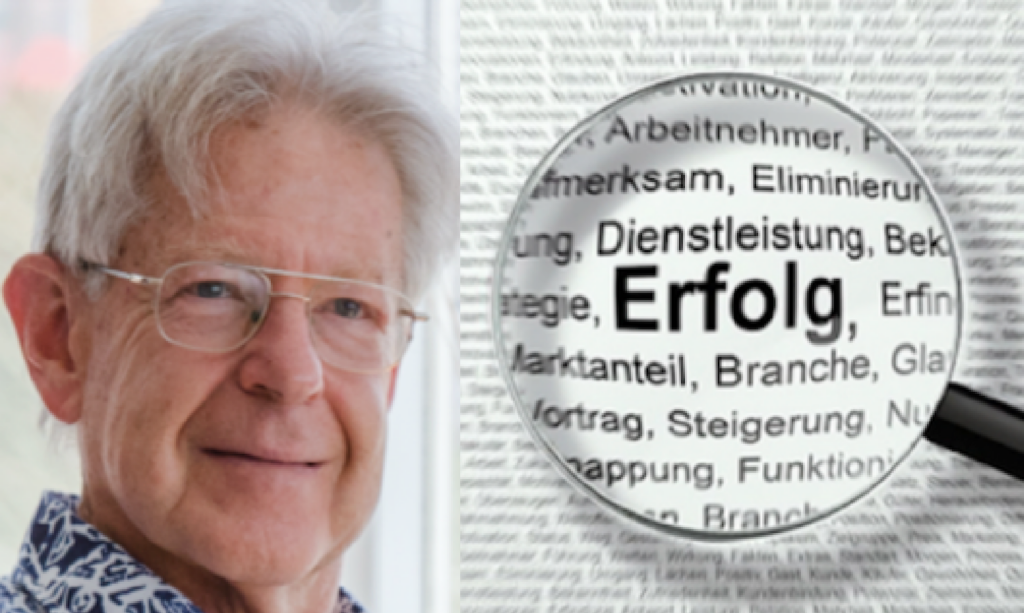Sprachlupe: Als Wort nicht mehr lecker – das Leckerli
Wie ist das Leckerli bloss auf den Hund gekommen? Jahrhundertelang war es Menschen vorbehalten, Rezepte aus der Schweiz und Süddeutschland («Leckerle») sind laut Wikipedia seit etwa 1600 überliefert. Heute kennt der gedruckte Duden nur Leckerli auf -i, als «honigkuchenähnliches Gebäck» mit Hinweis auf Basel. Online ist aber eine zweite Bedeutung dazugekommen, nicht als «schweizerisch», sondern als «umgangssprachlich» markiert: «Leckerei (besonders als Belohnung für Hunde)». Im Digitalen Wörterbuch (DWDS) steht sogar als erste Bedeutung: «als besonders schmackhaft empfundene essbare Kleinigkeit, die oft als Belohnung an ein Tier gegeben wird.» Erst an zweiter Stelle folgt das Schweizer Feingebäck.
Dwds.de zeigt auch eine Verbreitungskarte an; demnach kommt Leckerli in elektronisch erfassten Quellen Deutschlands und Österreichs etwa dreimal häufiger vor als in der Schweiz (bezogen auf die Gesamtzahl der jeweils erfassten Wörter). Das deutet stark darauf hin, dass die «tierische» Bedeutung heute überwiegt. Denselben Befund zeigen Stichproben in den Quellensammlungen (Korpora), die unterhalb der Karten angezeigt werden. Als ältester Beleg für die (noch nicht auf Tiere) übertragene Verwendung aus der Computerzeitschrift «C’t» von 1993): «Ein bei anderen Rechnern viel zu seltenes Leckerli hat sich Intel bei der parallelen Schnittstelle ausgedacht: Sie ist wahlweise unidirektional oder bidirektional konfigurierbar.» Da läuft einem das Blut in den Hackerfingern zusammen.
Ist das Müsli ein Leckerli?
Das zuallererst auf Abwegen ertappte Leckerli stammt bei den DWDS-Quellen aus der Untertitelung zum Film «The Howling» von 1981: «Zarte, fleischige, nahrhafte Leckerli». Da sie für Werwölfe bestimmt waren, bleibt die Frage offen, ob Mensch oder Tier. Danach kommen für Menschenkinder 1991 in der «Berliner Zeitung» die «vielen bunten Leckerli aus dem Laden». Lobenswert ist hier der Plural ohne s am Schluss. Der Duden «Rechtschreibung» und das DWDS sehen auch Leckerlis vor, nicht aber der Duden «Schweizerhochdeutsch».
Zudem bedeuten Leckerli bzw. Läckerli im Schweizer Spezialband immer Feingebäck; die andere Bedeutung ist ja auch nicht speziell schweizerisch, eher im Gegenteil. Schweizer Medien unterscheiden: Läckerli sind gemäss der Datenbank SMD fast immer kulinarisch, Leckerli häufig Dressurköder, manchmal auch solche für Menschen: «Er versprach mehr Geld für alle und reihte sich damit in jene Sportpräsidenten ein, die mit finanziellen Leckerli ihre Macht erlangen und zementieren.» Was der «Bote der Urschweiz» über die Herren der Skis und der Fussbälle schrieb, passt bestens dazu, dass das Eigenschaftswort lecker hierzulande nicht eben beliebt ist. Die Verbreitungskarten des DWDS zeigen eine ähnliche Abneigung auch in Österreich.
Wenigstens tritt der in Deutschland beliebte Plural Leckerlis in der Schweiz kaum auf. Dass unsere Nachbarn solche Wortanleihen zudem gern mit einem gedehnten Schluss-i garnieren, verleiht auch dem Müsli (dem à la Bircher, nicht dem Tierchen) einen Nebengeschmack. Als zusätzliche, schweizerische Schreibweise steht Müesli sogar im allgemeinen Duden; in «Schweizerhochdeutsch» ist das Wort nur mit e eingetragen, mit der Erklärung «dtl. Müsli». Doch diese «deutschländische» Form ist der einheimischen nach SMD-Zählung bereits hart auf den Fersen (da sind allerdings einige Dialekt-Mäuschen mitgezählt). Immerhin kommen all die Müsli im Plural wie die Leckerli fast durchwegs ohne Schluss-s aus (wie im DWDS nach Korrektur auch Räbeliechtli).
Ach so schweizig: Verhüterli
Anders sieht es bei den Verhüterlis aus: Wenn sie überhaupt in der Schweizer Presse auftauchen, dann meist so, mit Mehrzahl-s. Sie sind ja auch kein hiesiges Urgewächs, sondern ein Imitat aus Deutschland. Darüber habe ich mich 2018 in der «NZZ am Sonntag» ausgelassen. Als ich jüngst «duden verhüterli» googelte, kam zuoberst ein «Snippet» (Schnipsel) aus jenem Zeitungstext: «Seit Jürgen Drews in einem Schlager das ‹Verhüterli› besang, hat es in Deutschland Karriere gemacht. Der Duden führt es in der Online-Ausgabe als ‹scherzhaft gebildet mit schweizerischer Verkleinerungssilbe›; in Wahrigs Synonymen-Wörterbuch dagegen gilt das ganze Wort als ‹schweizerisch›». Drews hilft nach, mit jodeligem Auftakt und dem gedehnten Reim auf «ohne tun wir’s nie».
Damals hatte ich noch nicht hinter Drews’ Anti-Aids-Schnulze von 2007 zurückgeschaut. Zwar förderte diese gewiss die Verwendung sowohl der Sache als auch des Worts. Doch Google Books findet Verhüterli schon 1973 in einem Sammelband der Zeitschrift «Die Neue Gesellschaft». Da musste das Wort bereits eine Weile im Umlauf gewesen sein, denn es trat nun in einem übertragenen Sinn auf: «… rhetorische Verhüterli gegen die keimende Kraft der Basis». Mit diesen Mitteln versuchten CDU-Politiker, die Lockerung des Abtreibungsverbots zu vereiteln. 1981 stand das Wort dann im «Grossen Wörterbuch der deutschen Sprache» (Duden), samt Hinweis auf den Scherz mit Schweizer «-li». Dennoch dürften viele in Deutschland das Wörtli für echt niedlich schweizerisch halten. Dagegen ist noch kein Verhüterli gewachsen.
Weiterführende Informationen
- Indexeintrag «Helvetismen/Hochdeutsch» in den «Sprachlupen»-Sammlungen: tiny.cc/lupen1 bzw. /lupen2, /lupen3. In den Bänden 1 und 2 (Nationalbibliothek) funktionieren Stichwortsuche und Links nur im heruntergeladenen PDF.
 Quelldatei für RSS-Gratisabo «Sprachlupe»: sprachlust.ch/rss.xml; Anleitung: sprachlust.ch/RSS.html
Quelldatei für RSS-Gratisabo «Sprachlupe»: sprachlust.ch/rss.xml; Anleitung: sprachlust.ch/RSS.html
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.