Der Papst hängt sich eine weisse Weste um
Red. Der Autor ist Theologe und heute freiberuflicher Journalist. Er war 33 Jahre lang Kirchen- und Religionsexperte beim Zürcher Tages-Anzeiger. 2006 erhielt er den Preis für Freiheit in der Kirche und 2011 den Zürcher Journalisten-Preis für das Gesamtwerk. Letztes Jahr ist von ihm bei Herder das Buch «Der Papst der Enttäuschungen. Warum Franziskus kein Reformer ist» erschienen.
Just zum Auftakt des Heiligen Jahres 2025 legt Papst Franziskus seine Autobiographie «Hoffe» vor. «Die erste Autobiographie, die jemals von einem Papst veröffentlicht wurde», verspricht der Klappentext – ziemlich dreist.
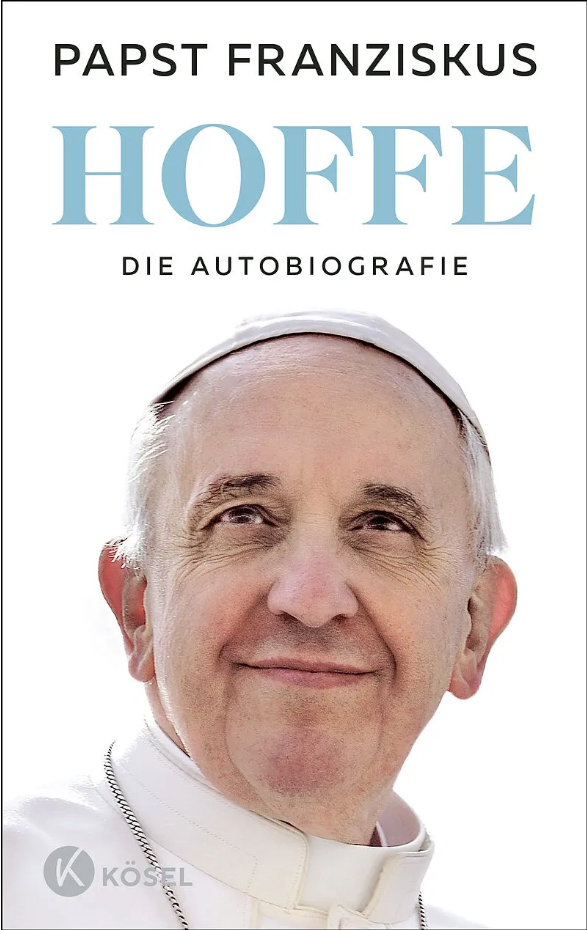
Hat doch Franziskus erst letztes Jahr, und auch damals «zum ersten Mal», die «Geschichte seines Lebens erzählt» unter dem Titel «Leben. Meine Geschichte in der Geschichte». Und 2020 bereits schilderte er im autobiografischen Buch «Wage zu träumen!», wie er persönlich immer wieder aus Krisen herausgekommen ist. Ganz abgesehen von all den Interviews, die er zu seinem Lebensweg gegeben hat. Das wirft die Frage nach dem Selbstverständnis eines Papstes auf, von dem mehr autobiographische Bücher als Enzykliken vorliegen. Sein Leben und sein Vorbild sind ihm offenbar wichtiger als die katholische Lehre.
Gewiss ein Papst hat viel zu erzählen, zumal einer wie Franziskus, der umtriebig und ruhelos durchs Leben geht, der die einflussreichsten Menschen dieses Planeten trifft, der aber auch die ärmsten und elendesten aufsucht, die Flüchtlinge auf Lampedusa und Lesbos, die Kriegsversehrten im Sudan und in Myanmar, die Geschundenen und Entrechteten im Amazonas oder im Irak. All diese Begegnungen schildert er – übrigens auch diesmal mit einem Ko-Autor, mit Carlo Musso – in Dutzenden, vielleicht Hunderten von biografischen Aperçus.
Familiengeschichte
Seine Herkunft aus einer Migranten-Familie erzählt Franziskus in seiner neuen Autobiografie ausführlicher als anderswo: Wie die Grosseltern mit seinem späteren Vater in der Zwischenkriegszeit aus dem armen Piemont ins aufstrebende Buenos Aires ausgewandert sind und nach dem Rückschlag der Weltwirtschaftskrise in der Mittelschicht des multireligiösen Viertels Flores Fuss fassten. Er skizziert eine glückliche Kindheit und Jugend, geprägt von frommen Verwandten, Ordensleuten und speziell von starken und liebevollen Frauen wie Oma Rosa oder der marxistisch-atheistischen Lehrerin Esther Ballestrino de Careaga. Das einfache Milieu in Buenos Aires war gerade nicht bildungsfern. Früh schon las Jorge Mario Bergoglio Manzoni, Dostojewski und Hölderlin, erbaute sich an Filmen von De Sica und Fellini und hörte Opern von Verdi, Bellini und Puccini. Theologische Referenzen nennt er dagegen nur spärlich.
Vieles schildert er in diesem Buch zum X-ten Mal: Die Entfernung des oberen Teils seines rechten Lungenflügels, die Ausbildung zum Chemietechniker, die Sitzungen bei einer Psychiaterin in dunklen Zeiten, seine Berufung, die Priesterweihe, der Eintritt in den Jesuitenorden, schliesslich das Konklave, das ihn zum Papst kürte. Alle Kapitel sind gespickt mit Anekdoten, mit Lebens-und Binsenwahrheiten und überbordenden moralischen Appellen. Eine Kostprobe: «Gerade für einen Gläubigen lebt die Dankbarkeit im Herzen des Glaubens: Ein Christ, der sich nicht bedanken kann, hat die Sprache Gottes vergessen». Die Moral von all den Geschichten drängt sich ungebeten in den Vordergrund. Gerade so, als hätten wir seine Botschaft von der Barmherzigkeit, von der Zuneigung für die Armen und Migranten noch immer nicht kapiert.
Imagepflege
Und doch ist das wohl kaum sein Grund, abermals auf 384 Seiten über sich selbst zu schreiben. Es geht dem 88-Jährigen wie vielen Autobiografen, zuletzt auch Angela Merkel, um die Rechtfertigung seines Tuns, gerade dort, wo er heftig kritisiert wurde. Die Kritik erwähnt er kaum, rückt das Kritisierte einfach ins richtige Licht. Das betrifft insbesondere seine andere Sichtweise auf Frauen, Gender, Homosexuelle und wiederverheiratet Geschiedene und ganz besonders seine politische Haltung im Ukraine- und Nahostkrieg oder während der Militärdiktatur in Argentinien.
Auf den von ihm nicht genannten Vorwurf, im Ukraine-Krieg Täter und Opfer nicht zu unterscheiden und von der Ukraine das Hissen der Weissen Fahne zu fordern, schreibt er: «Wir verwechseln nicht Angreifer und Angegriffene. Wir leugnen auch nicht das Recht auf Selbstverteidigung. Doch wir sind überzeugt davon, dass Krieg niemals ‹unvermeidlich› und dass Frieden immer möglich ist». Es folgen Appelle zum Frieden, zum Dialog, zu Verhandlungen, die auch von Sarah Wagenknecht stammen könnten. Er rechtfertigt all die diplomatischen Schritte, die der Heilige Stuhl angesichts des Krieges in der Ukraine unternommen hat, spart aber aus, wie wenig diese gefruchtet haben. Über sein fragwürdiges Treffen mit den russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill im Jahr 2016 und deren gemeinsame Erklärung samt überschwänglichem Lob auf die (vermeintliche) religiöse Renaissance im postsowjetischen Russland schweigt er sich gänzlich aus. Den Vorwurf, einseitig für die Palästinenser Partei zu ergreifen, kontert er, indem er den Überfall der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 erstmals eine „Barbarei“ und ein „Gemetzel“ nennt.
Dunkles Kapitel
Was seine politische Vergangenheit in Argentinien betrifft, erklärt er seine Sympathie für den Peronismus damit, dass die peronistische Doktrin klare Parallelen zur katholischen Soziallehre habe. Besonders ausführlich wird Franziskus, wo es um seine (umstrittene) Rolle im schmutzigen Krieg in Argentinien geht. Als Jorge Rafael Videla im März 1976 durch einen Militärputsch an die Macht kam, war Bergoglio Provinzial der argentinischen Jesuiten.
Natürlich kommt er auf die besonders kontrovers debattierte Episode zu sprechen, als die beiden in den Armenvierteln tätigen Jesuiten Orlando Yorio und Franz Jalics im Mai 1976 von Videlas Schergen entführt und gefoltert wurden. Zuvor hatte er die beiden linken Befreiungstheologen vom Schutz der Kirche ausgeschlossen und sie so der Militärjunta preisgegeben. Der Papst indes beteuert, er habe das Menschenmögliche für deren Freilassung getan. Ja er habe in Diktator Videlas Residenz eine Messe gefeiert, um sich für ihre Freilassung einzusetzen und diese dann beim Marineadmiral Massera auch erwirkt. All die Debatten, Vorwürfe, ja Gerichtsverhandlungen um die politischen Gefangenen und Verschwundenen in seiner Heimat lässt er unerwähnt, um seine eigene Version darzulegen, die Version eines Menschenfreundes und klugen Vermittlers, der sich unermüdlich für das Schicksal der Opfer der Militärdiktatur eingesetzt hat. Mit nahezu hymnischem Lob huldigt er dem Engagement der Mütter der Plaza de Mayo, die dem damaligen Jesuitenoberen Bergoglio mangelnden Einsatz für die Verschwundenen vorwarfen.
Verbrannte Erde
Hier liegt auch der Schlüssel, warum Franziskus während seines nun bald zwölfjährigen Pontifikats nie nach Argentinien zurückgekehrt ist, in sein Heimatland, «für das ich immer noch eine tiefe und grosse Liebe empfinde», wie er beteuert. Noch immer bete er jeden Tag für das argentinische Volk. Die Volksfrömmigkeit der Armen in den Villas (Slums) habe ihn zutiefst geprägt. Man erinnert sich: Der frisch gewählte Papst Johannes Paul II. liess sich in Warschau und Krakau feiern fast wie ein Messias. Auch Neopapst Benedikt XVI. wurde am Weltjugendtag in Köln triumphal empfangen. Warum aber hat Franziskus nie wieder einen Fuss auf argentinische Erde gesetzt? Wohl weil er die Proteste der Verschwundenen-Organisationen fürchtet, speziell die Kritik der Mütter von der Plaza de Mayo. Und wahrscheinlich auch von Betroffenenorganisationen der Missbrauchsopfer, die ihm in mehreren gravierenden Fällen in seiner Zeit als Erzbischof von Buenos Aires Versäumnisse, gar Vertuschung vorhalten. Doch auch bei diesem so delikaten Thema präsentiert sich Franziskus als Saubermann, als Papst, der von Anfang an entschieden gegen Missbrauch durch Kleriker und Vertuschung vorgegangen ist.
Selbstkritik
Natürlich räumt er Fehler ein und bezeichnet sich auch in dieser Autobiografie wiederholt als Sünder. Aber immer nur, wenn es um persönliche Belange geht, bei Versäumnissen und Feigheiten gegenüber einzelnen Personen seines Umfelds, was man unter den lässlichen Sünden abbuchen muss. In den wirklich relevanten Belangen seiner öffentlichen Rolle, bei der Bewältigung des Missbrauchsskandals und seiner geopolitischen Haltung aber fällt das Wort Sünder nicht. Hier will er der umsichtige Leader sein, der stets nach bestem Wissen und Gewissen handelt.
Heiligsprechung
Vielleicht beugen sich dereinst Kleriker des Dikasteriums für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse über das Buch, das von einem moralisch vorbildlichen Menschenfreund und Pontifex mit weisser Weste handelt. Und womöglich widerfährt Franziskus posthum, was er selbst gleich drei Päpsten des 20. Jahrhunderts angedeihen liess: Die Heiligsprechung. Dass Franziskus so viele seiner Vorgänger heiliggesprochen hat, wie kein anderer Papst vor ihm, erfährt man in der Autobiografie freilich nicht.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.










Mir bleibt er vor allem unangenehm in Erinnerung wenn ich an seine Aussage denke «impfen ist Nächstenliebe». Ob dies eine Eingabe von «oben» ist oder nur einfach eine fahrlässige Bemerkung ist nicht bekannt. Was allerdings inzwischen bekannt ist, dass die Impfung nicht unerhebliche Nebenwirkungen hat und im Falle von Kinder/Jugendlichen und gesunden Erwachsenen völlig unnötig ist. Nicht alle seine Schäfchen werden es ihm danken -:)
Wikipedia Absolution: «..Mit der Absolution findet die Feier des Bußsakraments ihren Abschluss. Vorher muss der Sünder sein Tun bereuen und die ernste Absicht zur Besserung haben („guter Vorsatz..»
Interessante Aussage im Artikel: «Natürlich räumt er Fehler ein und bezeichnet sich auch in dieser Autobiografie wiederholt als Sünder.» Könnte es wohl sein, dass der Papst noch nicht erkannt haben könnte, dass wer Busse tut, nach der Absolution wieder sündigen kann und darf?
Gunther Kropp, Basel
Es ehrt Sarah Wagenknecht, dass sie zu den wenigen politisch Aktiven gehört, deren Friedensappelle zum Krieg in der Ukraine denen des Papstes ähneln. Die Christliche Union, für die in früheren Zeiten katholische Bischöfe in Hirtenbriefen versteckt Wahlkampf gemacht haben, überhört geflissentlich diese Friedensappelle. Und wenn Michael Meier dem Papst vorwirft, dass all seine diplomatischen Schritte wenig gefruchtet hätten, so kann man aber wenigstens feststellen, dass sie im Gegensatz zu den Durchhalteparolen und Waffenlieferungen der Kriegswilligen keine Leichen und zerfetzte Körper in den Gräben und auf den Schlachtfeldern hinterlassen haben. Es ist schade, dass die täglichen Friedensappelle des Papstes so wenig Widerhall finden. Aber zumindest setzt er seine diplomatischen Mittel für einen Frieden ein, im Gegensatz zu vielen anderen „Diplomaten“, die außer „weiter drauf“ nichts drauf haben.
Die Äußerungen des Papstes zum Ukrainekrieg sind sehr vernünftig. Warum soll der Papst auf absurde Vorwürfe – wie den, Täter und Opfer nicht zu unterscheiden – eingehen? Im Ukrainekrieg sind längst alle Täter, weil alle Beteilgten machtpolitische Interessen verfolgen anstatt Kompromisse einzugehen. Zu der höchstens mißverständlichen Wortwahl „Hissen der Weißen Fahne“ ist alles bereits bekannt. Die Wortwahl stammt von dem fragenden Journalisten und der Papst hat sie nur aufgegriffen. Der Papst hat darunter selbstverständlich das Signal zu Frieden und zur Verhandlungsbereitschaft verstanden – und nicht ein Zeichen der Kapitulation. Apelle des Papstes zu Frieden, zum Dialog, zu Verhandlungen werden vom Autor kritisiert, weil sie auch von Sarah Wagenknecht stammen könnten? Das ist für mich keine sachliche Kritik (sondern Polemik).