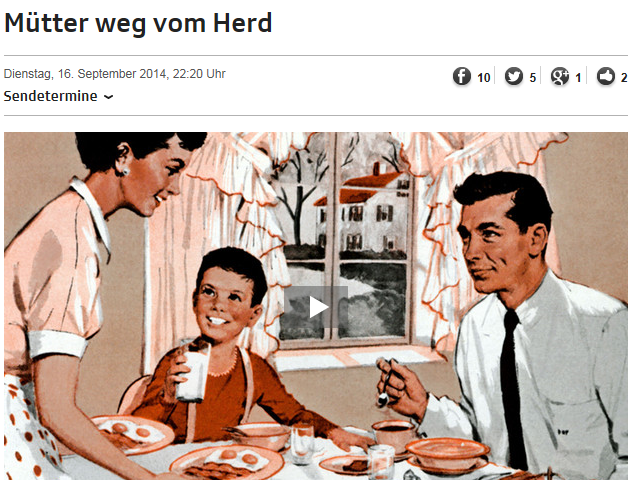«Notnagel» Frauen
Haben ganz durchtriebene Feministinnen die SVP unterwandert und die Masseneinwanderungsinitiative nur lanciert, um «die Wirtschaft» endlich zu mehr Geschlechtergleichheit – die sich sogar rechnen würde, wie auch in diesem «Club» mehrmals und zu Recht betont wurde – zu zwingen? «Wer A gesagt hat am 9. Februar, muss jetzt auch B sagen», brummte Hans Hess, Präsident von Swissmem und Vizepräsident der Economiesuisse. Womit er die Moderatorin Karin Frei zum Ausruf «Masseneinwanderungsinitiative führt zu Frauenförderung» provozierte.
Darauf angesprochen, ob es «der Wirtschaft» wirklich ernst sei und weshalb das eben verfasste «Superstrategiepapier» der Swissmem – das offensichtlich den Eintritt der Frauen in die Männerwelt der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie fördern soll und bei dem, so Frei, «jeder emanzipierten Frau das Herz höher» schlage – erst jetzt komme, bekannte Hess angesichts der demnächst in Rente gehenden geburtenstarken Jahrgänge und der mehr Life-Work-Balance fordernden jüngeren Generationen: «Wir haben gar keine andere Wahl; wenn wir 16‘000 haben, die pensioniert werden, nur 6‘000 neue reinbringen und vom Ausland wenige holen können, haben wir gar keine andere Wahl.» In der Not frisst der Teufel Fliegen. Nach einem grundsätzlichen Kulturwandel tönt das nicht.
Wenn die eine Manövriermasse ausfällt
Weil es für eine auf ständig steigende Gewinne ausgerichtete Ökonomie undenkbar ist, bei «Fachkräftemangel» das Wachstumsdogma in Frage zu stellen – obwohl in Zusammenhang mit der Masseneinwanderungs- beziehungsweise der Ecopop-Initiative vereinzelt&zaghaft durchaus wachstumskritische Äusserungen gemacht wurden&werden – führt der Verlust der einen Manövriermasse, der AusländerInnen, zum Griff nach der anderen, den Frauen. Natürlich geht es «der Wirtschaft», wenn sie Frauenförderung betreibt, so wenig um Gleichstellung der Geschlechter wie, wenn sie Einwanderungsbeschränkungen bekämpft, um internationale Solidarität. Ihre migrations- und geschlechterpolitischen Positionen sind das Resultat ökonomischer Notwendigkeiten&Begehrlichkeiten.
Der Titel des «Clubs» – «Mütter weg vom Herd» – enthält im Subtext denn auch bereits den konjunkturellen Gegentrend: Frauen zurück an den Herd. Wie er beispielsweise in Deutschland, als die überlebenden Männer aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkamen, gesellschaftliche Realität wurde und in der Schweiz auch schon mal mit der Diffamierungsformel «Zweitverdienerin» Geschlechterverhältnisse mit-definierte.
Die volatile Herd-Propaganda unterschlägt, woran Rebekka Risi (Direktorin der Geschäftsstelle Modell F, welche die Vereinbarkeit von Beruf, Ausbildung und Familie im so genannten «War for Talents» zu fördern versucht) in der eher privilegierten Nacht-Runde verdienstvollerweise erinnerte: Für grosse Teile, vermutlich sogar für die Mehrheit der Bevölkerung ist die gleichzeitige Erwerbsarbeit von Mann und Frau, nicht «nur» Wunsch, sondern ökonomische Notwendigkeit. Viele können nicht einfach traditionelle Rollen tauschen, wie das die Sulzer-IT-Chefin Ursula Soritsch-Renier mit ihrem (Haus-)Mann&Künstler tut und, ganz «Erfolgsmann», die Qualität über die Quantität des Zusammenseins mit ihrem Kind stellt: «Wenn ich zu Hause bin, dann bin ich da für mein Kind.»
Väter an den Herd
Und wie immer, wenn es um den Herd geht, ist zuerst einmal ausschliesslich von Frauen die Rede, oder wer hat schon mal den Slogan «Väter an den Herd» beziehungsweise seine Gegen-Variante «Väter weg vom Herd» gehört, gelesen, verwendet? Auch die zwei Millionen Männer, die laut Markus Theunert (Fachmann für Männer- und Geschlechterfragen) «weniger und flexibler arbeiten möchten» – nur die Präsidentin der Hausfrauen- und Hausmännergewerkschaft Lydia Terrani wies darauf hin, dass das Wort «Arbeiten» nicht bloss für bezahlte Tätigkeiten verwendet werden dürfe –, auch diese männlichen Millionen haben bisher weder Herd&Staubsauger gestürmt noch sind sie für Geschlechtervisionen, die über die konjunkturelle Nutzung der «Ressource Frau» hinausgehen, auf die Strasse gegangen.
Wo es um reale Geschlechtervisionen geht, dürften die wirtschaftlichen Risiken nicht länger einseitig auf den flexiblen Menschen abgewälzt und Geschlechter- sowie Beziehungsvorstellungen der Konjunkturlage unterworfen werden. Da müsste, umgekehrt, Flexibilität von privaten Unternehmungen und öffentlicher Verwaltung eingefordert werden, das heisst Anpassung von Arbeitsprozessen an die Unwägbarkeiten menschlichen Lebens mit und ohne Kinder, mit und ohne lebenslange Lieben. Die Überwindung traditioneller Geschlechterkonzepte, hin zur Teilung der Verantwortung für Haus und Existenzsicherung, zöge eine breitere Verteilung von Entscheidungskompetenzen und eine Enthierarchisierung im öffentlichen Bereich nach sich, die es möglich machte, dass wirtschaftliche und politische Gremien beziehungsweise Institutionen flexibler auf die Unberechenbarkeiten des Lebens reagieren könnten, so dass es nicht mehr zwingend den Chief Executive Officer (CEO) brauchte, um ungedeckte Kredite abzuschreiben, die Präsidentin, um den Rückzug der Armee zu beschliessen, oder den Bundesrat, um die OLMA zu eröffnen. Die mit der Überwindung der Geschlechterdifferenz verbundene Flexibilisierung des privaten Alltags würde so nicht länger als günstige Rahmenbedingung des deregulierten Weltmarktes instrumentalisiert, vielmehr würde, umgekehrt, der öffentlichen Sphäre mehr Beweglichkeit abgerungen, was eine Voraussetzung für die wirkliche Gleichheit (der Geschlechter) wäre.
Die alte Angst vor der Gleichheit
Aber da bekäme es womöglich sogar der Präsident von «männer.ch» Markus Theunert – der «mehr Emanzipation als Imitation männlicher Lebensläufe» fordert – mit der Angst zu tun, der, zusammen mit Ivo Knill, in der «SonntagsZeitung» vom 31. August 2014 über den «Garten Schweden» schreibt: «Mannsein und Frausein werden auf den biologischen Kern reduziert und gleichzeitig von möglichst allen sozialen Prägungen ‹befreit›.» Die beiden Schwedenreisenden feiern zwar das familienpolitische Paradies – «Wir spüren Sehnsucht nach der Anerkennung, die der schwedische Staat den Eltern ideell und finanziell entgegenbringt… Im Vergleich zu Schweden nehmen wir uns aus wie ein Land, das keine AHV und keine Arbeitslosenversicherung kennt.» – und freuen sich über das «Selbstbewusstsein der schwedischen Frauen», aber dann packt sie die alte Angst vor der Gleichheit: «Ist Gleichheit wirklich der zivilisatorische Fortschritt, wie unsere schwedischen Gesprächspartner zu betonen nicht müde werden? Fehlt nicht etwas, wenn wir die Annahme überwinden, es sei schön, dass es ‹Männer› und ‹Frauen› gebe?»
Gleichheit ist erst eingelöst, wenn die Geschlechtergrenzen durch offenes Land ersetzt sind, auf dem sich die Unterschiedlichsten frei bewegen können. Es ist ja gerade nicht die Überwindung der Geschlechterdifferenz, die Unterschiede einebnet, sondern die gesellschaftlich hervorgebrachte Dualität von «Mann&Frau» – sie glättet mit klaren Zuordnungen die vielfältigen Unterschiede zwischen als «Mann» beziehungsweise «Frau» stereotypisierten Individuen aus. An diese Vertrautheit des eigenen Kollektivs&Geschlechts klammern wir uns wie der Vogel, der den geöffneten Käfig nicht verlässt, weil ihm die vergitterten fünfzig Zentimeter vertrauter sind als der weite Himmel.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine