Gegen den unguten Zeitgeist
«Gegen nukleare und militärische Aufrüstung. Für echte Sicherheit.» Dies die Parole des Ostermarsches am 21. April in Bern. «Was Frieden schafft», wird gleichentags in Bregenz beim Bodensee-Friedensweg gefragt. Unter dem Peace-Zeichen postuliert die Einladung dort noch «Neugier statt Spaltung». Eine eigenwillig motivierende Ergänzung.
Alles andere als einfach und klar
Dass ich an Ostern da oder dort oder an einem anderen Ort dabei bin, ist klar – seit nun gut sechs Jahrzehnten, mit Unterbrüchen zwar und inhaltlich wechselnden Akzenten. Denn die Gefahr war nie gebannt, die Willenskundgebung für eine Sicherung von Frieden durch bessere als militärische Mittel immer am Platz. In diesen Tagen wohl mehr denn je. Aber es ist heute alles andere als einfach, klare Zeichen zu setzen gegen den unguten Zeitgeist, der rundum dominiert: Kriegstüchtigkeit sichern, die Armee mit bestem Gerät rüsten, A-Waffen beschaffen …
Wieder wie damals? Nein, schlimmer. Immerhin wütete vor sechzig Jahren – zumindest auf unserem Kontinent – nur ein Kalter Krieg. Noch gab es von der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs her den Reflex eines «Nie wieder!», und erschütternde Bilder aus Hiroshima und Nagasaki wirkten als Warnung vor dem atomaren Desaster. Vorab diese Fotos hatten mich als Lehrling zum frühen politischen Engagement in pazifistischer Richtung bewegt. Als wir 1963 beim ersten schweizerischen Ostermarsch nach ganzen drei Tagen mit starken Gefühlen am Genfer Sitz der Vereinten Nationen ankamen, war dieses Gebäude für uns ein Symbol der Hoffnung auf friedliche internationale Zusammenarbeit.
Für atom- und armeefreie Zonen
In jenen Jahren, die auch von Debatten um eine atomare Aufrüstung der Schweiz sowie zwei Volksabstimmungen zu diesem Thema geprägt waren, bin ich erstmals den konkreten Vorschlägen für atomwaffenfreie Zonen in Mitteleuropa begegnet. Wir wollten unser Land, das sich so gern auf seine Neutralität und die humanitäre Tradition mit dem Roten Kreuz berief, als aktive Kraft in solche Bündnisse einbringen. Weil die diplomatischen Vorstösse für Pufferregionen vorab aus Ländern östlich des sogenannten Eisernen Vorhangs kamen, waren sie antikommunistisch und militärfreundlich geprägten Kreisen doppelt suspekt. Mich hatte der Gedanke als eine Möglichkeit der Gefahrenminderung überzeugt, ja als Schritt zu weiteren Beschränkungen des tödlichen Wettrüstens begeistert. Ein völlig armeefreies Gebiet wagten wir uns allerdings kaum vorzustellen.
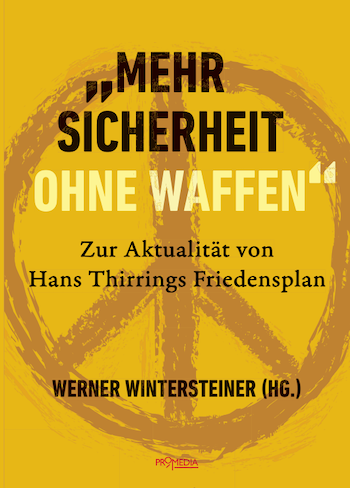
Spannend, diesem Ansatz jetzt in einer differenzierten historischen Rückblende wieder zu begegnen. Bei der Dokumentation, die eine 1963 in Österreich publizierte Denkschrift neu vorlegt, ist bereits der Titel eine Herausforderung: «Mehr Sicherheit ohne Waffen». Völlig konträr zum momentanen Zeitgeist! In der «im Jänner» verfassten Einleitung stellt Werner Wintersteiner – ein 1951 in Wien geborener und nun emeritierter Professor an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt – als Herausgeber fest: «Das war damals eine Provokation, und das ist heute erst recht eine.» Doch angesichts eines von Kriegslogik dominierten Diskurses, in dem Friedensbemühungen zum Tabu würden und Aufrüstung nicht mehr hinterfragt werden dürfe, sei ein Erinnern an andere denk- und begehbare Wege notwendiger denn je.
Chancen friedlicher Koexistenz
Entsprechend wird auf dem Cover die «Aktualität von Hans Thirrings Friedensplan» betont. Nicht dass dieser in global völlig anderer Konstellation direkt anwendbar wäre. Schon der eingangs abgedruckte Originaltext war ja ausdrücklich als ein Vorschlag zur Prüfung «an das österreichische Volk und seine gewählten Vertreter» gerichtet. Hans Thirring, selbst SPÖ-Parlamentarier, betonte, er habe sein Konzept nicht in dieser Funktion verfasst, sondern als tief besorgter, «die Möglichkeiten nuklearer Waffen überblickender Physiker». Nach einer früheren Publikation hatte ihn Albert Einstein zum Einsatz in der Friedensbewegung ermutigt. Eine intensive Beschäftigung mit Dynamiken des Hochrüstens und der Blockade begonnener Verhandlungen für ein Atomtestverbot ging dem Vorstoss voraus. Die positive Reaktion auf in diesem Zusammenhang an John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow gerichtete Briefe sprachen für die Chance einer friedlichen Koexistenz der Systeme. Und die radikale Abrüstung eines neutralen Staates «ohne umstrittene Grenzen» könnte zum zukunftsträchtigen Testfall werden. Statt seine Neutralität mit der Wehrmacht zu sichern, solle sich Österreich dem Schutz durch die Vereinten Nationen unterstellen.
Hätte sich nicht auch die Schweiz als Testfall geeignet? «Für die Schweizer hat vor allem der Glaube an die Notwendigkeit einer Landesverteidigung fast den Rang eines religiösen Dogmas angenommen», befand Thirring. Zudem könne die sich wohl «den Luxus einer seit mehreren Generationen nicht in Aktion tretenden Armee» eher leisten. Bei einer positiven Entwicklung internationaler Bemühungen für eine bessere Friedenssicherung wäre aber bald mit weiteren Staaten in entsprechenden Bündnissen zu rechnen. Vom «guten Willen» der Nachbarn, ein abgerüstetes Österreich nicht anzugreifen, war er überzeugt. Wahrscheinlich würden sie diese Pioniertat sogar unterstützen.
Blicke auf Gegenwart und GSoA
Was der Vorschlag damals in und um Wien ausgelöst hat, auch die vielseitigen, im Buch mit Blick auf die Gegenwart angestellten Überlegungen zu alternativen Konzepten kann ich hier nicht wiedergeben. Nachzulesen wäre auch, wie eng das Abschaffen von Krieg und Patriarchat aus feministischer Sicht zusammenhängt. Unbedingt zu erwähnen ist der Beitrag von Andreas Gross, der den Thirring-Plan und «die konkrete Utopie» einer Schweiz ohne Armee verknüpft.
Die von ersterem zumindest indirekt inspirierte Volksinitiative sei «die erfolgreichste Niederlage der schweizerischen Demokratiegeschichte» gewesen, stellt der an diesem Juso-Projekt aktiv Beteiligte fest. Dass sich mehr als eine Million darüber abstimmender Schweizerinnen und Schweizer, bei Jüngeren unter 30 gar die Mehrheit für «eine umfassende Friedenspolitik» ohne Militär entschied, war überraschend. Speziell die Rückblenden in die Vorgeschichte sind erhellend und erfrischend. Anfänglich sprach der Präsident der SPS von einer «Furzidee». Natürlich war dann der Abstimmungstermin ideal: Ende November 1989! Das von Gorbatschow als Vision skizzierte «gemeinsame Haus Europa» schien Realpolitik zu werden … Danach wird der 1988 von einer sozialistischen Jugendorganisation lancierte Vorschlag zur Entmilitarisierung Sloweniens und für eine gesamtjugoslawische Friedenskonferenz dokumentiert. Was da folgte, war auf tragische Weise anders. Doch dass und wie Costa Rica seit 1948 tatsächlich ohne Armee auskommt, hellt das Bild wieder auf.
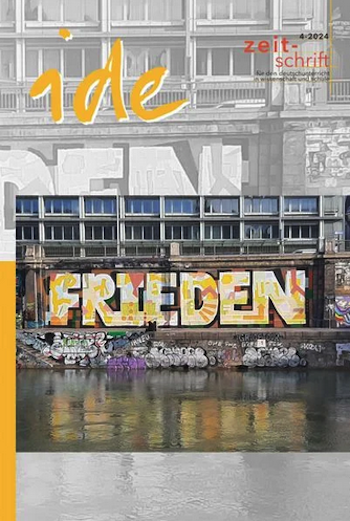
Wer die Diskussion in Österreich weiter verfolgen will und sich für Friedensarbeit an der Basis interessiert, sei noch auf einen Band verwiesen, den Werner Wintersteiner als ehemaliger Leiter eines Zentrums für Friedensforschung gemeinsam mit Sabine Zelger, einer ähnlich engagierten Germanistin, publizierte: «Frieden» als Thema für den Deutschunterricht. Es wäre jetzt besonders wichtig. Zumal über Literatur und Film könnten «widerspruchsreiche Friedensvorstellungen» erschlossen, produktiv auf- und ausgebaut werden. Die in den Beiträgen aufgeworfenen Ideen, aber auch offenen Fragen «zum stets unvollkommenen Frieden» seien eine Einladung an uns alle.
Bemerkenswert finde ich, wie oft und wie vielfältig die pädagogische Schriftenreihe den Themenkomplex in den letzten Jahren aufgegriffen hat. Auch im Anhang des notabene von «Stadt Wien Kultur» finanziell geförderten Buches zum Thirring-Plan wird vermerkt, Anti-Militarismus habe in Österreich «immer eine grosse Rolle gespielt, auch wenn viele Traditionen in Vergessenheit geraten sind». Ein historischer Streifzug könnte neue Initiativen inspirieren.
Für «riesige Aufgabe» zu klein
Für die hiesige Friedensbewegung war seit 1945 der Schweizerische Friedensrat zentral. Die zeitweise recht starke Dachorganisation ist durch ihren Sitz an der Gartenhofstrasse in Zürich, dem Haus der Familie Ragaz, traditionell pazifistisch verortet und steht allen auch für Einzelmitgliedschaften offen. Weil bei diesen ein Abonnement der «Friedenszeitung» im Jahresbeitrag enthalten ist, steckt schon in der nüchternen Angabe zu deren Auflage eine Aussage zur Lage: 2000 Exemplare sind für «die einzige friedenspolitische Zeitschrift der Schweiz» wenig. In der März-Ausgabe sind Spuren von Ohnmacht und Zerrissenheit der verbliebenen Engagierten zu finden. Es sei eine «riesige Aufgabe», die vor bald achtzig Jahren in Angriff genommen wurde, hält der Bilanztext fest, den ein kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges verfasster Satz des Kabarettisten Karl Valentin eröffnet: «Hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist.» Dies passe auch in unsere Zeit zunehmend friedloser Unsicherheit.
Die letzten paar Nummern waren von Analysen zur Ukraine und vom erneuten Kampf um ein Atomwaffenverbot in der Schweiz geprägt. Zudem war die Suche nach alternativen Verteidigungs- und Sicherheitskonzepten ein Schwerpunkt. In einem «Positiv-Szenario 2025-2040», übernommen aus einer deutschen Denkschrift, taucht wieder «eine UNO-gesicherte Neutralitätszone zwischen Nato-Staaten und Russland» auf. Wie von der derzeit verfahrenen Situation dorthin gelangen?
Ein gleichfalls aus Deutschland, von der Zeitschrift des Netzwerks Friedenskooperative übernommener Text hält fest, durch «Putins Imperialismus» seien alte Grundkonflikte der Bewegung wieder aufgebrochen; sie wirke «gespalten und orientierungslos», und je kleiner sie sei, desto mehr Einfluss bekämen wie bei der Ost-West-Polarisierung im Kalten Krieg offenbar jene, welche «ein eher taktisches Verhältnis zu Pazifismus und Antimilitarismus» hätten. Das dürfte sich bei den Ostermärschen zeigen. In der «Friedenszeitung» finden sich wie üblich die Aufrufe zu zwei Anlässen: Ostermarsch Bern und Bodensee-Friedensweg. Zu letzterem wird angemerkt, dass diesmal «ein Redebeitrag aus der Schweiz fehlt» und dort in der Vorschau auch nach nun drei Jahren Krieg gegen die Ukraine «keinerlei Solidarität mit den Angegriffenen» bekundet werde.
Kaum realpolitisch, aber richtig
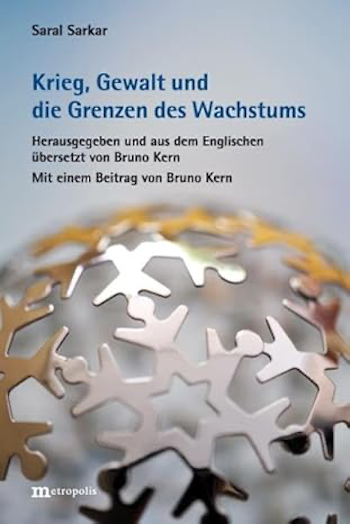
Trotzdem fahre ich wieder ins Dreiländereck. Bregenz, das diesmal Veranstaltungsort ist, liegt näher als Bern. Zudem entspricht mir ein «Weg» heute mehr als «Marsch». Natürlich werde ich darauf achten, was zum Krieg gesagt und ob etwas beschwiegen wird. Bei den angekündigten Referaten erwarte ich von Helga Kromp-Kolb, dass sie als Fachfrau die Klimafrage einbringt. Pete Hämmerle ist Theologe, aktiv in pazifistischen Organisationen, er will Europa wieder als Friedensprojekt sehen. Bruno Kern kenne ich aus Büchern. «Das Märchen vom grünen Wachstum» lag mir speziell nah. Seine im Januar neu erschienene Übersetzung von «Krieg, Gewalt und die Grenzen des Wachstums» des indisch-deutschen Saral Sarkar, der ökosozialistische Alternativen propagiert, knüpft daran an. Ein aktueller Essay – ein Versuch eben, der kritisch zu prüfen wäre. So scheint mir das Problem der Überbevölkerung überschätzt und Zeugen wie Malthus oder Konrad Lorenz bleiben mir selbst bei differenzierender Relativierung suspekt. Realpolitisch lassen sich derzeit kaum Ansätze zur im Buch postulierten radikalen Wende erkennen. Doch die skizzierte Richtung ist richtig.
Gespannt las ich das Nachwort, wo der Herausgeber selbst Stellung bezieht. «Russlands Angriff war nicht alternativlos»; aus pazifistischer Sicht gebe es keine Rechtfertigung. Für ernstgemeinte Friedenspolitik sei mit einzubeziehen, was die andere Seite als Bedrohung sieht. Um ihres Überlebens willen müsste die Menschheit alle materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen auf die Bewältigung ihrer ökologischen Krise konzentrieren. Wir müssten «den Krieg gründlich verlernen». Zu den fünf von Kern genannten «unmittelbaren politischen Konsequenzen» gehört «eine Bundesrepublik ohne Armee». Ob und wie er all dies im Kurzreferat unterbringt? Wir werden es auf dem Platz der Menschenrechte in Bregenz hören.
Dieser Text erscheint auch als «Politeratour»-Beitrag im «P.S.»
- «Mehr Sicherheit ohne Waffen». Zur Aktualität von Hans Thirrings Friedensplan. Hrsg. von Werner Wintersteiner. Promedia-Verlag, Wien 2025, 245 Seiten, ca. 35 Franken
- Frieden. Reflektieren und Imaginieren, Zweifeln und Hoffen, Arbeiten an einer Kultur des Friedens. Hrsg. von Werner Wintersteiner und Sabine Zelger. «informationen zur deutschdidaktik», Band 4/2024. Studienverlag Innsbruck, 142 Seiten, ca. 30 Franken
- Friedenszeitung. Nr. 52 / März 2025. 32 Seiten, vier Ausgaben 50 Franken. Probeheft via info@friedensrat.ch.
- Saral Sarkar: Krieg, Gewalt und die Grenzen des Wachstums. Mit einem Beitrag des Herausgebers Bruno Kern: Den Krieg gründlich verlernen. Metropolis, Marburg 2025, 138 Seiten, ca. 26 Franken
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.










Mich stört an diesen Ostermärschen in der Schweiz die pro Ukrainische Antirussische Haltung. Wer Frieden und Abrüstung ernst meint, muss auf alle zu gehen. Ohne dass, ist die Protestveranstaltung für mich, nur eine Lifestyle Farce. Persönlich bin ich für eine Schweiz ohne Armee aus tiefster Überzeugung und ich kenne den Verein. Konnte aber mit der GSOA nie warm werden, die viel zu stark von SP und Grünen instrumentalisiert wird. Jo Lang hat es bewiesen, in dem er in der BZ sich stark für die Aufrüstung der Ukraine machte. Was ich zuerst nicht fassen konnte. Die sogenannte Friedensbewegung in der Schweiz, hat für mich jegliche Glaubwürdigkeit verloren.
Es ist Zeit für geschichtliche Aufklärung, Anerkennung für das grosse Leid, dass Russland durch Europa, unserer Geschichte, ertragen musste und uns immer wieder vergeben hat. Putinversteher heisst Russland-Versteher und Russland besteht aus 143 Millionen wunderbaren, gastfreundlichen Menschen die sich Frieden wünschen.
Die Friedensbewegung wird auf dieselbe infame Art und Weise zersetzt wie Occupy Wall Street, mit dem böswilligen Framing / Desinformation «Rechtsextreme» und «Nazis», i.S.v. «Wird der Bürger unbequem bezeichne ihn als rechtsextrem».
Siehe auch t-online vom 19.04.25, die Schlagzeile: «Dieter Hallervorden spricht auf rechtsextremer Demonstration» (=Friedensdemo). Gegendemo «Omas gegen Frieden»…..
Hans Steiger zitiert am Schluss seines Artikels folgende Sätze: «Um ihres Überlebens willen müsste die Menschheit alle materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen auf die Bewältigung ihrer ökologischen Krise konzentrieren. Wir müssten «den Krieg gründlich verlernen». Dem kann ich nur zustimmen.
An den Ostermärschen wird sicher auch gesagt, dass Kriege oft auch bei uns beginnen, in dem wir Waffen liefern und Geldhäuser Milliarden in ausländische Rüstungskonzerne investieren, die sogar Atombomben herstellen. Diese Institutionen investieren in ausländische Rüstungskonzerne die Bomben, Granaten, Munition, Minen, Flugzeuge, Kanonen und Panzer nach Israel und in die Ukraine liefern. Ohne diese Rüstungsgüter könnte Israel und die Ukraine keinen Tag Krieg führen.
Mit Wolfgang Borchert kann man dazu nur sagen: «Du Mann und Frau bei der Bank: Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst weiter mithelfen Geld in ausländische Rüstungskonzerne zu investieren dann gibt es nur eins: Sag NEIN!»