Kommentar
Dank Trump: Der Bundesrat knickt gegenüber der Techbranche ein
In den Neunzigerjahren galt die Technoszene des Silicon Valley als besonders liberal. Das Garagen-Image der Tech-Unternehmen und junge Nerds, welche die digitale Revolution voranbringen wollten, prägten das Bild. Politisch war man gegen Beschränkungen bei der Abtreibung und kämpfte für die Rechte der queeren Gemeinschaften. Noch vor zwei Jahren warnten die Vertreter der KI-Firmen selbst vor einer ungeregelten Entwicklung von KI. Diese habe das Potential, die nationale Sicherheit und Wahlen zu gefährden und letztlich Millionen von Arbeitsplätzen zu vernichten.
Mit der Wiederwahl von Donald Trump am Ende des letzten Jahres hat sich der Wind gedreht. Firmen wie Meta, Google, OpenAI fordern nun die Trump-Regierung auf, staatliche KI-Gesetze zu blockieren und die Nutzung urheberrechtlich geschützten Materials zum Trainieren ihrer KI-Modelle für legal zu erklären. Doch wie konnte es dazu kommen, dass seit die seit den 1990er Jahren zu Reichtum und Einfluss gekommenen Tech-Magnaten mit fliegenden Fahnen zu Donald Trump überliefen?
Eine Studie der Stanford University vermutet, dass sich dieser Wandel während der letzten Jahre schleichend vollzogen hat. Es sei zwar richtig, dass die befragten rund 600 Tech-Unternehmer während der ersten Präsidentschaft von Donald Trump zu den linksgerichteten Demokraten gehörten. Sie traten für eine Wirtschaftspolitik ein, welche Wohlstand umverteilte, und machten sich für eine allgemeine Krankenversicherung stark. Allerdings standen die befragten rund 600 Personen, welche der Elite der Tech-Branche angehörten, gleichzeitig staatlichen Regulierungsbemühungen zutiefst misstrauisch gegenüber. Der englische «Guardian» kommt zu einem ähnlichen Schluss: Der liberale Ruf der Techbranche sei irreführend. Ihre reaktionären Tendenzen – die Verherrlichung von Reichtum, Macht und traditioneller Männlichkeit – seien schon seit den 1990er Jahren deutlich erkennbar gewesen.
Wie persönliche Freiheit und freie Märkte zusammenhängen
Das erklärt, weshalb sich die politische Ausrichtung vieler führender Köpfe der Hightech-Branche so rasant nach rechts verschoben hat. Die Tech-Milliardäre haben sich mit Donald Trump verbündet und gehen in Mar-a-Lago ein und aus. Sie vertreten vorgeblich das Recht auf freie Meinungsäusserung und meinen damit vor allem ihre eigene Freiheit, um mithilfe ihrer Plattformen politisch Einfluss zu nehmen und KI ohne Einschränkungen weiterzuentwickeln. Das beste Beispiel dazu ist Elon Musk. Seit er im letzten Juli offiziell seine Unterstützung für Trump verkündet hatte, haben seine politischen Tweets auf X insgesamt über 17 Milliarden Aufrufe erzielt – mehr als doppelt so viele Aufrufe wie die von allen politischen Werbeposts auf X zusammen.
Unter Druck geraten auch traditionelle Medien wie die angesehene «Washington Post» seit sie von Amazon-Chef Jeff Bezos übernommen wurde. Dieser verlangte von der Redaktion, sich beim Wahlkampf um die Präsidentschaft neutral zu verhalten. Und kürzlich hat er auf X nachgedoppelt. Im Jargon der libertären Hightech-Millionäre schreibt er: Künftig würden in der «Washington Post» nur noch Meinungen publiziert, die zur Unterstützung von zwei Prinzipien beitrügen: persönliche Freiheiten und freie Märkte.
Wie der Kampf um die «Meinungsfreiheit» jedoch diese selbst bedroht, zeigt Trumps Erlass zur «Beendigung radikaler und verschwenderischer DEI-Programme und Bevorzugung durch die Regierung». Darin knebelt er Universitäten und die Freiheit der Wissenschaften, indem er Fördermittel für Diversität, Gleichberechtigung, und Inklusion (DEI) zusammenstreicht. Trump bezeichnet DEI-Bemühungen als «illegale und unmoralische Diskriminierungsprogramme» und «öffentliche Verschwendung».
Fast täglich in den Schlagzeilen steht Elon Musk, den Trump jenseits jeder parlamentarischen Kontrolle zum Leiter des Department of Government Efficiency (DOGE, deutsch: Abteilung für Regierungseffizienz) ernannt hat. Musk krempelt damit nach dem Muster seiner eigenen Firmen den Staatsapparat radikal um. Zehntausende Angestellte fürchten um ihre staatlichen Arbeitsplätze.
Der Masterplan zum Umbau der USA
In den USA sehen dies viele Kritikerinnen und Kritiker als eine Art Staatsstreich. Denn es sind mittlerweile keine Einzelfälle mehr. Universitäten entlassen unter Druck Mitarbeiter, verhängen Einstellungsstopps, schliessen Labore und sehen sich mit staatlichen Ermittlungen konfrontiert. Von aussen gesehen scheint in den USA plötzlich Willkür und Chaos auszubrechen.
Doch das scheinbare Chaos hat Methode: Das Drehbuch all dieser Massnahmen, das unter dem Vorwand läuft, überflüssige und verschwenderische Bürokratie abzubauen, wurzelt auf einem umfassenden Programm, das von der christlich-konservativen Heritage Foundation über Jahre ausgearbeitet wurde. Darin wird auf 922 Seiten ein Plan beschrieben, um die USA nach radikal rechten Vorstellungen umzubauen. Fast zwei Drittel der bisherigen Erlasse Trumps sollen direkt oder teilweise aus dem «Project 2025» stammen. Das zeigt eine Analyse der US-amerikanischen Zeitschrift «Time Magazine».
Digitale Technologien: Ein Mittel der Macht
In ein solches Szenario passt die sich anbahnende Koalition mit der Tech-Elite: Die Datenökonomie von Hightech soll die Leerstelle auffüllen, die mit dem Kahlschlag einer Bürokratie entsteht, deren regelbasierte Strukturen zerschlagen werden. Ein Zusammenbruch der Ordnung wird durch digitale Instrumente aufgefangen, welche gleichzeitig die Effizienz des Regierens und die totale Überwachung der Bürger gewährleisten. Auf eine Anfrage bei Microsoft Copilot, antwortet das KI-System verräterisch: «KI kann dabei helfen, riesige Datenmengen zu analysieren und komplexe Muster zu erkennen, was staatliche Überwachungsmechanismen erheblich stärkt. Technologien wie Gesichtserkennung, automatische Datenauswertung und Verhaltensanalysen ermöglichen eine präzise Überwachung der Bürger.» So wird die Hightech-Industrie zur zentralen Säule einer neuen Machtstruktur, die auf Daten und Algorithmen statt auf Bürokratie setzt.
Die Europäische Union hat zur Eindämmung solcher Gefahren schon im letzten Jahr eine KI-Verordnung erlassen, welche die Risiken einer ungebremsten Entwicklung verhindern soll. Die KI-Verordnung folgt einem risikobasierten Ansatz. KI-Technologien werden in vier verschiedene Risikokategorien aufgeteilt, die mit unterschiedlich strengen Vorschriften verbunden sind – von «KI-Systemen mit inakzeptablem Risiko» über «KI-Systemen mit hohem Risiko» und «KI-Systemen mit Transparenzanforderungen» bis zu «KI-Systemen mit keinem/niedrigem Risiko».
Die Schweiz dagegen will die KI so regulieren, dass ihr Potential für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Schweiz nutzbar gemacht wird. Zwar gibt es bei uns keine Musks, welche die Regierung beraten. Aber die Algorithmen von Social Media könnten auch bei uns die politische Meinungsbildung beeinflussen oder sogar manipulieren. Doch infolge des schwelenden Zollstreits mit den USA knickt der Bunderat nun ganz ein. Gemäss TagesAnzeiger verzichtet er auf ein geplantes Gesetzzur Regulierung der KI. Er vertagt die geplante Regulierung von Kommunikationsplattformen wie Google, Facebook, Youtube und X auf unbestimmte Zeit oder vielleicht bis zum St. Nimmerleinstag.
In der Schweiz mit ihrer direkten Demokratie sollte die Mahnung des ehemaligen Bundeskanzlers Walter Thurnherr nicht vergessen werden: «Wenn die Demokratie KI nicht beherrscht, wird KI die Demokratie beherrschen».
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.





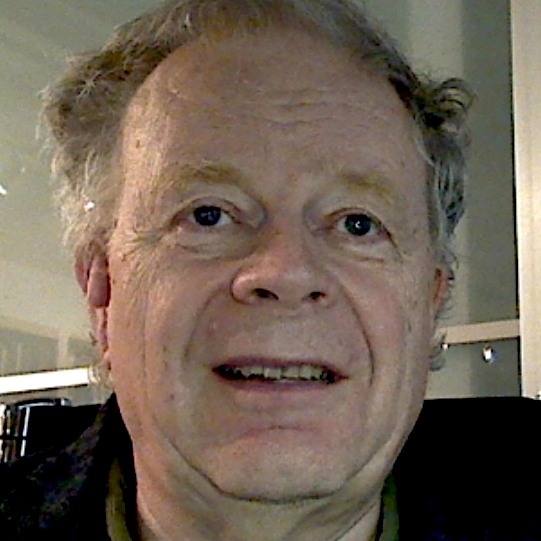


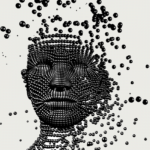


Möglich, dass der Bundesrat erkannt haben könnte, dass die High-Tech-Milliardärs-Cowboys die Überzeugung haben könnten die Welt retten zu können, wie Superman in seinen Filmen. Bekanntlich handelte Superman gratis im Gegensatz zu den Cowboys, die wohl den Traum haben könnten für ihren Einsatz, die absolute politische und finanzielle Kontrolle über den Globus als Belohnung erlangen zu können. Die High-Tech-Cowboys könnten auch erkannten haben, dass Donald Trump bedingt durch sein Alter eine begrenzte biologische Zeit hat. Und seine möglichen geschäftlichen Missgeschicke durch High-Tech und KI glattgebügelt werden könnten, damit alle wieder glücklich sind, weil ein High-Tech-Cowboy das Weisse Haus übernehmen kann. Darum wohl:
» Dank Trump. Der Bundesrat knickt gegenüber der Techbranche ein. »
Gunther Kropp, Basel