Was Trumps Comeback für Lateinamerika bedeutet

Bereits vor der Amtsübergabe machten Trumps Pläne für die Aussenpolitik im benachbarten Lateinamerika Schlagzeilen. Er kündigte an, die Einwanderung über den Rio Grande zu stoppen und mehrere Millionen Menschen abschieben zu wollen, die ohne Aufenthaltsgenehmigung in den USA leben. Den Ländern des Subkontinents, die sich gegen den Willen der Weltmacht sperren, drohte er mit einem Paket von wirtschaftlichen Sanktionen. Zudem kündigte der US-Präsident an, er wolle den Panama-Kanal für die USA «zurückholen».
Dass Trumps Ankündigungen mehr sind als heisse Luft, zeigt sich schon jetzt. Fast täglich werden entsprechende Erlasse und Gesetze verabschiedet. Auf einem Notfall-Gipfel wollten die Staaten Lateinamerikas eine gemeinsame Strategie erarbeiten gegen die geplanten Massenabschiebungen von Migrantinnen und Migranten sowie gegen Trumps Zollandrohungen. Doch die kurzfristig einberufene Dringlichkeitssitzung der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (Celac) wurde abgesagt. Zu unterschiedlich sind die Interessen der einzelnen Staaten.
Trumps Ziel: China zurückdrängen
Im «IPG-Journal» ist die Rede von einer «Trump-Doktrin», die vor allem eines zum Ziel habe: den wachsenden Einfluss Chinas in Lateinamerika einzudämmen. Dazu bietet der Beitrag, auf das Wichtigste konzentriert, eindrückliche Daten und Fakten. Lateinamerika, so lesen wir, dürfte unter Trump viel deutlicher in Gut und Böse unterteilt werden. Das berge auch Chancen: Wer sich schlau genug anstelle, «wer also Trump hofiert und neue Kreditanträge als strategische Investition gegen China ‹verkaufe›», der könne durchaus profitieren von finanziellen Zuschüssen der USA und Institutionen wie dem Weltwährungsfonds (IWF) und der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB).
Anders sieht der kolumbianische Politikwissenschaftler Juan Gabriel Tokatlian den Machtwechsel in Washington und seine Bedeutung für Lateinamerika. In einem Interview der britischen «BBC Mundo» wird in einer kurzen Rückblende auf Trumps erstes Mandat an Misserfolge und Enttäuschungen erinnert. Der Halbkontinent im Süden Amerikas sei Trump stets fremd geblieben. Er habe während seines ersten Mandats kein einziges Land Lateinamerikas besucht – ausser Argentinien, weil dort ein Treffen der G20 stattfand. Trump werde vermutlich auch in seinem zweiten Mandat eher bilaterale Kontakte suchen, als gemeinsame Interessen zwischen dem Norden und Süden des amerikanischen Kontinents zu betonen.
Hohe Zölle für Waren aus Mexiko
Mexiko ist eines jener Opfer, die den eisernen Besen des «Hurrikan Trump» als Erste zu spüren bekommen. Trump drohte mit neuen Zöllen (25 Prozent) ab dem 4. Februar für Waren aus Mexiko. Die seit wenigen Monaten regierende Präsidentin Claudia Sheinbaum konnte in letzter Minute in einem Telefongespräch mit Trump einen Aufschub von 30 Tagen erreichen. Sie versprach dem US-Präsidenten, 10’000 Soldaten an die Nordgrenze zu schicken. Doch ihre Sorge über die drohende Störung des Aussenhandels mit dem mächtigen Nachbar bleibt. Wichtig, so moniert die «Berliner Morgenpost», sei auch die Frage, wie weit in Zukunft die Abwicklung der Geldüberweisungen beeinträchtigt werden könnte, mit denen etwa 12 Millionen in den USA ansässige Mexikaner und Mexikanerinnen ihre Angehörigen in der Heimat unterstützen.
Empört reagierte der Staatspräsident von Panama, José Raúl Mulino, auf das Ansinnen Trumps, den Panama-Kanal «zurückholen» zu wollen, der vor einem Vierteljahrhundert mittels Vertrag in die Hände des kleinen Staates am Isthmus übergegangen war. Das käme einer eindeutigen Verletzung des Internationalen Rechts gleich, warnte Mulino den Amtskollegen im Weissen Haus.Vorsorglich rief die gemässigt konservative Regierung von Panama die Charta der Vereinten Nationen an und alarmierte auch den 15-köpfigen Sicherheitsrat der UNO.
Noch schärfer verurteilte das Staatsoberhaupt von Honduras, die linksgerichtete Xiomara Castro, Trumps Pläne in der Region. Jegliche Sanktion oder andere Art von Repressalien würde die Regierung in Tegucigalpa als «feindseligen Akt gegen Honduras» betrachten, sagte sie laut dem Online-Portal «amerika21». In den letzten Monaten ist der Ton zwischen den Regierungen in Honduras und den USA merklich schärfer geworden. Umstritten ist nicht nur ein Vertrag, der die Auslieferung von geständigen Rauschgifthändlern an die Amerikaner regeln soll. Auch beharrliche Gerüchte über Umsturzpläne gegen die Regierung Castro und deren Widerstand gegen die zeitlich unbegrenzte Präsenz von US-Truppen auf dem Stützpunkt Palmerola im Landesinnern haben zu einer schrittweisen Vergiftung der Beziehungen beigetragen.
Kolumbien: Trump erzwingt Abschiebungen mit Zöllen
Wie Donald Trump Zoll-Drohungen als politisches Druckmittel einsetzt, hat sich jüngst exemplarisch in Kolumbien gezeigt. Präsident Gustavo Petro verweigerte zwei US-Militärmaschinen mit abgeschobenen Migranten die Landeerlaubnis. Kurzerhand kündigte Trump an, er werde sogenannte «Notzölle» in Höhe von vorerst 25 Prozent, später 50 Prozent, auf kolumbianische Importwaren verhängen lassen. Zudem drohte er dem Land mit weiteren Sanktionen. Kolumbiens Staatschef Petro gab sich zunächst kämpferisch und kündigte ebenfalls Zölle an – doch letztlich knickte die Regierung ein und stimmte allen Bedingungen Trumps zu.
Ein weiteres Thema beschäftigt derzeit in Kolumbien: Nach heftigen Kämpfen rivalisierender Rebellengruppen mit mindestens 100 Toten hat Präsident Gustavo Petro den Notstand ausgerufen. Damit droht dem Land die Rückkehr in eine düstere Vergangenheit, die dieser Nation seit 1948 – der Ermordung des linksliberalen Politikers Jorge Eliécer Gaitán – endloses Leid und Gewalt mit Hunderttausenden Toten beschert und Millionen Menschen zur Flucht und Emigration getrieben hat.
EU wetteifert mit China um die Gunst Lateinamerikas
Noch vor wenigen Wochen wurde die Unterzeichnung des Handelsvertrags zwischen der Mercosur-Gruppe und der Europäischen Union gefeiert. Dabei müssten die Verantwortlichen in beiden Lagern eigentlich wissen, dass dieses Abkommen noch längst nicht in trockenen Tüchern ist. Es muss von den Parlamenten aller beteiligten Länder ratifiziert werden, was auf südamerikanischer Seite wahrscheinlich viel leichter zu erreichen sein wird als bei den Mitgliedstaaten der EU. Kommt hinzu, dass die Vertragspartner im Norden der Erdkugel in den vergangenen drei Jahrzehnten mühsamster Beratungen die Latinos oft als zweitrangige Partner zu behandeln schienen.
Unterdessen bekundet auch China seine wirtschaftlichen Interessen in der Region und hat seine Aktivitäten deutlich ausgebaut, wie im «IPG-Journal» ausgeführt wird. Mit einer Fülle von bemerkenswerten Einzelheiten erfahren wir, wie in diesem Wettlauf um die Gunst des Subkontinents gekämpft wird. Dass dieser dabei letztlich – nach wie vor – vor allem als Rohstofflieferant dienen soll, ist nicht zu übersehen.
Durchzogene Bilanz in Argentinien und Brasilien
Argentiniens Tageszeitung «Ámbito» hat den Jahreswechsel zum Anlass genommen, um nach einem Jahr radikal-libertärer Wirtschaftspolitik der Milei-Regierung erste Bilanz zu ziehen. Was die nackten Zahlen, die hier aufgelistet werden, für Hunderttausende Landsleute bedeuten, die inzwischen vor allem aus dem unteren Mittelstand in die Armut oder noch tiefer ins Elend abgerutscht sind, kann man sich denken. Zwar gibt es gewisse Indizien, dass die Talsohle erreicht sein könnte. Gleichzeitig stellt sich aber die Frage, wie viel sozialen Schaden die «Kreissägepolitik» von Milei angerichtet hat. Manche Sachverständige sind der Meinung, dass sich Argentiniens Ökonomie heute nahe beim «Tod durch Ersticken» befinde.
Bilanz wird auch in Brasilien gezogen, und zwar bei Halbzeit im dritten Mandat von Präsident Lula da Silva. Gestützt auf statistisches Material, das zur Hauptsache von der alternativen Medienplattform «Brasil de fato» recherchiert und von «amerika21» ergänzt wurde, ergibt sich der Trend zu einer generellen Verbesserung bei den Lebensbedingungen der ärmeren Bevölkerungsteile.
Dem widersprechen teilweise Aussagen von Personen, die auf dem Boden der sozialen Realität stehen und vor übermässiger Zuversicht warnen. João Pedro Stedile, Vorsitzender der landesweit organisierten MST (Landlosenbewegung), wirft der Regierung ohne Umschweife vor, so gut wie nichts für die Agrarreform, das wichtigste Anliegen grosser Teile der Landbevölkerung, unternommen zu haben. Laut einem Bericht in «amerika21» warten 65‘000 brasilianische Bauernfamilien seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten auf die Verwirklichung von Versprechen amtlicher Instanzen. Stattdessen sind die Besitzlosen wachsender Bedrohung durch Banden im Dienst von Grossgrundbesitzern ausgesetzt. Auch darüber hat «amerika21» berichtet.
Politischer Kurswechsel in Venezuela
Verblüffende Pirouetten vollzieht die Politik mittlerweile in Venezuela. Vom «Sozialismus des 21. Jahrhunderts», den Hugo Chávez den Massen von Parteigängern einst versprach, ist sein Nachfolger Nicolás Maduro inzwischen weit entfernt. Nach einem langen Abstieg der einst reichen und bürgerlich-demokratisch regierten Erdölnation bewegt er sich in raschen Schritten auf einen «autoritären Kapitalismus» hin. «BBC Mundo» hat diverse Wirtschafts- und Sozialforscher aus universitären Kreisen befragt, um die Hintergründe dieses überraschenden Wandels zu verstehen. Wie kommt es, dass der US-amerikanische Erdölgigant Chevron plötzlich eine Joint Venture mit der einheimischen Staatsfirma PDVSA bilden kann? Unter welchen Bedingungen darf der indische Jindal-Konzern die reichen Eisenerzvorkommen im Orinoco-Gebiet ausbeuten?
Auf Seiten lokaler Unternehmer freut man sich über den unverhofften Kurswechsel der Regierung Maduro. Obwohl bei den letzten Wahlen im Juli 2024 vermutlich nicht alles mit rechten Dingen zuging, hört man einen Mann des Unternehmerdachverbands Fedecámaras jubeln, die Entwicklung in Venezuela sei nunmehr «sehr positiv». Es sei ein Verhandlungsprozess in Gang gekommen und dabei finde «ein wirklicher Dialog» statt. Warmen Applaus erntet der üblicherweise autoritär auftretende Staatschef auch dafür, dass in den letzten Monaten nicht weniger als 48 früher verstaatlichte Betriebe wieder reprivatisiert worden sind.
______________________________________
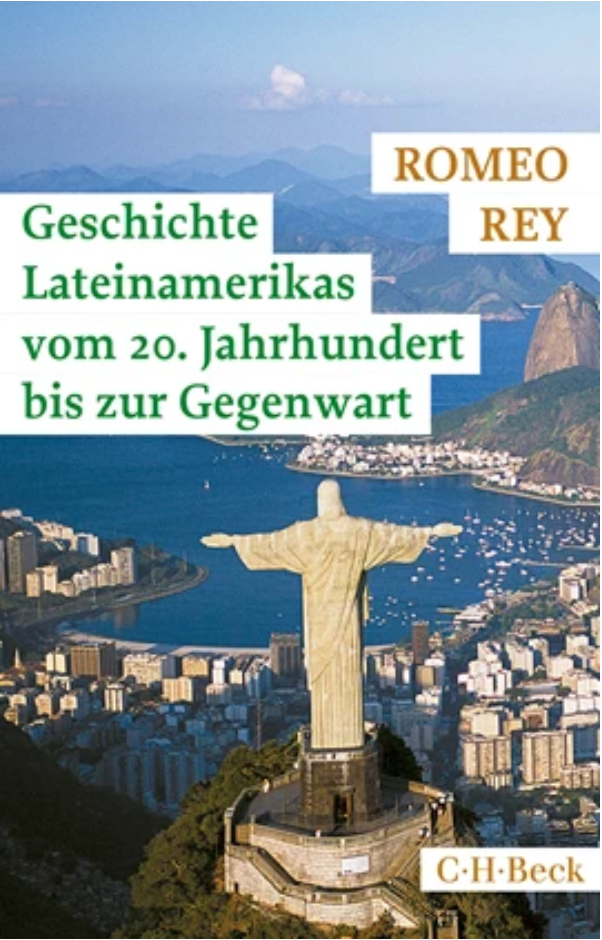
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine. Der Autor war 33 Jahre lang Korrespondent in Südamerika, unter anderem für den «Tages-Anzeiger» und die «Frankfurter Rundschau».
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
Mit Twint oder Bank-App auch gleich hier:
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.











Interessante Aussage im Artikel: «Donald Trumps zweite Amtszeit wird erhebliche Auswirkungen auf Lateinamerika haben.» Möglich, dass die Mittel- und südamerikanischen Staaten erkennen, dass es ausser den USA noch weitere Handelspartner-Nationen gibt mit denen gute Geschäfte gemachte werden könnten und der US-Markt verliert an Bedeutung und arbeitslose US-Bürger werden in die boomenden südamerikanischen Staaten ziehen. Und es wird ein neuer Slogan entstehen: Vom Bananenpflücker zum Millionär.
Gunther Kropp, Basel