Kommentar
Ökonomen können besser zählen als denken
Zählen kann jeder. Denken ist schwieriger. Ökonomen sind besonders gut im Zählen. Dank dem Preismechanismus können sie Kraut und Rüben, Dienstleistungen und Waren gleichnamig machen, addieren und ins Verhältnis setzen. Das BIP etwa, die Staatsquote oder das Budgetdefizit. Ob alle dieser Rechnerei und Zählerei geht leicht das vergessen, was real hinter diesen Zahlen steckt. Das führt dann dazu, dass Fragen falsch gestellt oder Probleme gar nicht erst gesehen werden und ungelöst bleiben. Dazu ein paar Beispiele.
Unbezahlte Arbeit: Der Kitt der Gesellschaft
Da ist etwa die «unbezahlte» Arbeit. Schon der Begriff ist vielsagend. Er impliziert, dass Arbeit eigentlich bezahlt sein sollte. Was nicht bezahlt wird, hat auch keinen Preis und kann nicht addiert werden. Damit fällt die unbezahlte Arbeit weitgehend aus dem Blickfeld der Ökonomen und Wirtschaftspolitiker. (Die männliche Form ist hier bewusst gewählt.) Dabei genügt ein Minimum an Lebenserfahrung, um zu erkennen, dass die nicht bezahlte Arbeit in Familie und Nachbarschaft der Kitt der Gesellschaft ist. Schon Babys wissen und erfahren das, auch wenn sie es nicht formulieren können.
Was würde es an unserer Wirtschaftspolitik ändern, wenn die Ökonomen auch die unbezahlte Arbeit auf dem Bildschirm hätten? Dann müsste man sich beispielsweise Gedanken machen über die optimalen Rahmenbedingungen der unbezahlten Arbeit. Wie können wir dafür sorgen, dass Familien und Nachbarschaften besser funktionieren, und somit produktiver werden? Wie vertragen sich diese Anforderungen – etwa an kürzere Arbeitswege – mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes? Wie finden wir den optimalen Mittelweg für das Wohlbefinden aller?
Doch weil wir nur das beachten, was wir zählen und addieren können, denken wir kaum über diese Fragen nach. Deshalb sind wir jetzt daran, die ganze Kindererziehung vom Säuglingsalter an und die ganze Altenpflege zu kommerzialisieren. Was einst innerhalb von Familien und Nachbarschaften mit kurzen Wegen erledigt werden konnte, wird jetzt dem Markt überantwortet – mit seiner ganzen (Arbeits-)Bürokratie, Schulung, Kontrolle etc. Und damit sich die nun enkellos gewordenen Grosseltern oder die pensionierten Nachbarn nicht langweilen, schlagen sie sich die Zeit auf Kreuzfahrten tot.
Krankheiten vermeiden statt verwalten
Zweites Beispiel: Gesundheit. Die Menschheit wird immer kränker. Übergewicht, Diabetes, Krebs, Alzheimer, psychische Krankheiten – alles nimmt zu, auch in der Schweiz. Wir wissen auch, dass dies in erster Linie die Folge einer ungesunden Lebensführung ist. Eigentlich müssten wir ernsthaft darüber diskutieren, wie wir unsere Lebensgewohnheiten verbessern und wieder gesünder und damit viel besser leben könnten. Wie bringen wir die Leute dazu, sich mehr zu bewegen, weniger Zucker zu konsumieren, oder nur schon ihre Vitamin- und Mineralstoffdefizite aufzufüllen? Die Eidgenössische Ernährungskommission (EEK) geht etwa von einer «weit verbreiteten Vitamin-D-Unterversorgung in der Schweiz» aus. Mit Kosten von weniger als 5 Franken pro Kopf und Jahr könnten wir diesen Mangel beheben.
Doch statt über die Lösung des eigentlichen Problems zu reden, dreht sich die Diskussion bloss darum, wie wir die Krankheit mit weniger Kosten erdulden und verwalten können. Weil wir aufs Zählen getrimmt sind, leiden wir zwar jede und jeder für sich, aber als Kollektiv fühlen wir in erster Linie den finanziellen Schmerz der Krankheit. Unsere Hauptsorge gilt dem, was wir mit Geld beziffern können: Gut 90 Milliarden Franken jährliche Gesundheitskosten. Monatlich 684 Franken Krankenkassenprämie für eine Durchschnittsfamilie mit 2,1 Personen. Ein weiterer Anstieg um 8,7 Prozent im laufenden Jahr. Diese Entwicklung muss gebremst werden. Aber bitte schön nicht indem wir die Krankheit möglichst vermeiden. Das wäre ein harter Schlag – nicht nur für unsere Pharmaindustrie, sondern auch für unser BIP.
Altersvorsorge: Sorge um das Geld verdeckt die soziale Realität
Drittes Beispiel: Altersvorsorge. Auch hier verdeckt die Sorge um das Geld die soziale Realität. Die Diskussion um die 13. AHV-Rente etwa drehte sich vor allem um den Topf des AHV-Reservefonds. Die Befürworter argumentierten, dass dieser auch mit einer 13. Rente noch lange voll genug sei. Die Gegner malten das Schreckgespenst einer drohenden AHV-Pleite an die Wand. Ähnlich verläuft die Diskussion um die Reform der 2. Säule. Deren Reserven würden nicht reichen, wenn der Umwandlungssatz von aktuell 6,8 Prozent nicht auf mindestens 6 Prozent gesenkt werde, sagen die Befürworter. Die Gegner hingegen weisen darauf hin, dass es in Anbetracht der aktuell mehr als 1200 Milliarden Franken im BVG-Topf keinen Grund gebe, die Renten zu senken oder noch mehr in den Topf einzuzahlen.
Doch statt über die Tiefe der Töpfe sollten wir über den tieferen Sinn der Altersvorsorge diskutieren: Wir leben nun mal in einer Marktwirtschaft, in der die Arbeitskräfte ab 64 allmählich in Rente gehen. Sie arbeiten nicht mehr, müssen aber trotzdem konsumieren, bzw. mit Kaufkraft ausgestattet werden. Ob dies mit einem Umlageverfahren à la AHV oder mit einem Kapitaldeckungsverfahren wie in der 2. Säule geschieht, ändert nichts an der Tatsache, dass die Aktiven einen Teil der von ihnen erarbeiteten Kaufkraft an die Rentner abtreten müssen.
Fragt sich bloss, wie viel? Wenn wir davon ausgehen, dass das erklärte Ziel die Fortführung des gewohnten Lebensstandards ist, ergibt sich folgende Grössenordnung: Wenn wir nach 45 Arbeitsjahren in Rente gehen und 20 weitere Jahre unseren Lebensstandard (mit 80 Prozent des bisherigen Nettoeinkommens) sichern wollen, dann müssen die heute Aktiven (wenn sie ebenfalls 45 Jahre arbeiten) rein rechnerisch gut 25 Prozent des Lohneinkommens auf die hohe Kante legen bzw. an die Rentner abtreten.
Zum Vergleich: Mit der AHV – die für fast die Hälfte aller Rentnerhaushalte die wichtigste Einkommensquelle ist – werden gerade mal 8,7 Lohnprozente angespart. Anderseits können die Angestellten etwa der Swiss Re dank der AHV, den Beiträgen in die 3. Säule und vor allem dank der gut ausgebauten Pensionskasse mehr als 40 Prozent ihres Lohneinkommens steuerfrei sparen. Mit der Folge, dass in den Pensionskassen Jahr für Jahr nach allen Renten und Kapitalauszahlungen 37 Milliarden Franken netto angespart werden.
Diese Fakten aus der realen Welt legen den Schluss nahe, dass ein Ausbau der AHV zulasten der 2. Säule durchaus sinnvoll sein könnte. Vor allem aber deuten sie an, wie die Diskussion um unsere Altersvorsorge verlaufen könnte oder sollte, wenn wir auch die volkswirtschaftliche und sozialpolitische Realität hinter den Zahlen zur Kenntnis nehmen würden. Stattdessen streiten wir über den Pegelstand der jeweiligen Reservetöpfe.
Staatsausgaben: Gesellschaftlicher oder privater Nutzen?
Viertes Beispiel: Die Staats- oder Fiskalquote. Vor allem die bürgerlichen Parteien und ihr Thinktank «Avenir Suisse» glauben, dass eine tiefe Staatsquote per se von Vorteil sei. Zitat: «Entgegen der Wahrnehmung im öffentlichen Diskurs besitzt die Schweiz schon lange kein Alleinstellungsmerkmal mehr bei der Staats- und Fiskalquote: Hier marschiert unser Land im Gleichschritt mit vielen europäischen Ländern mit.» Dies sei unter anderem deshalb schlecht, weil: «Immer weniger wird die Frage gestellt, ob Ausgaben tatsächlich einem gesellschaftlichen oder doch eher einem primär administrativen Bedürfnis entsprechen – oder sogar nur der Bedienung von Partikularinteressen dienen.»
Das ist interessant: Da werden staatliche Ausgaben danach beurteilt, ob sie gesellschaftlichen oder bloss privaten Interessen dienen.» Doch sollen wir deshalb Staatsausgaben, die zuweilen auch privaten Interessen dienen, durch private Ausgaben ersetzen, die – per Definition – nur privaten Interessen dienen? Zugegeben, die Frage ist polemisch, aber sie macht klar, dass auch private Ausgaben nicht einfach deshalb sinnvoll sind, weil Private damit ihren Nutzen maximieren. Zwar lassen Steuersenkungen die Staatsquote schrumpfen, aber – wenn das «Partikuläre» die Möglichkeit verschafft, noch mehr Jachten und Drittresidenzen bauen zu lassen – werden dadurch keine «gesellschaftlichen Bedürfnisse» befriedigt.
Zu schlechter Letzt: Ökonomen messen zwar viel und gern, aber sie wollen gar nicht erst wissen, was genau sie da messen: Real gesehen ist das BIP die Gesamtheit aller Güter und Dienstleistungen, die von den Einheimischen im Verlaufe eines Jahres produziert worden sind. Wie viele Werte jeder einzelne Vermögensverwalter, Bauer oder Bauarbeiter geschaffen hat, ist unbekannt. Genau beziffern lässt sich nur, was jeder für seine Arbeit kassiert. Das ist ein Problem. Doch die Ökonomen denken gar nicht darüber nach, sondern erfinden den Sammelbegriff der «Produktivität». Sie setzen einfach Wertabschöpfung mit Wertschöpfung gleich. Und sie zitieren Statistiken wonach die «Produktivität» eines Finanzdienstleisters zweieinhalbmal so gross ist wie die eine Maurers und fünfmal die eines Bauern.
Doch wäre die Schweiz besser dran, wenn jeder Bauer und Maurer mit einem Vermögensverwalter ersetzt würde? Diese Frage kann man nicht mit Messen und Zählen beantworten. Da hilft nur Denken.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.





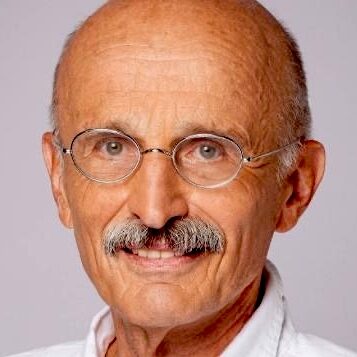



Für einen Ökonomen gibt es drei Sphären der Wirtschaft: Hauswirtschaft, Marktwirtschaft, kriminelle Wirtschaft. Nur in der Marktwirtschaft werden Güter und Leistungen über den Preismechanismus gemessen. Die Akteure können privat oder staatlich sein. Auch in der kriminellen Wirtschaft funktioniert ein Preismechanismus, aber aus verständlichen Gründen können Ökonomen hier nicht messen.
Das heisst aber nicht, dass die Ökonomen die Hauswirtschaft und die kriminelle Wirtschaft weniger schätzen als die Marktwirtschaft. Aber sie können in diesen beiden Sphären nicht messen.
Was stimmt: Wenn sich Aktivitäten aus Hauswirtschaft und krimineller Sphäre in die Marktwirtschaft verschieben, vermelden Ökonomen ein Wirtschaftswachstum, obschon die gesamte Wirtschaft nicht gewachsen ist.
Brillant. Vor allem der Schluss-Satz. Herzlichen Dank 🙂
Darf ich fragen, wie sie die ‹rechnerisch gut 25 Prozent des Lohneinkommens auf die hohe Kante legen› berechnet haben? Welchen Sparzins haben sie angenommen? Ich habe, ohne Zins, 35% bekommen, weil 16 volle Jahreslöhne in 45 Jahren angespart werden müssen.
Die Rechnung des Autors Werner Vontobel beruht auf der Annahme eines Umlageverfahrens und geht so: Wenn ich 45 Jahre lang je einen Viertel des Einkommens zur Seite lege, oder den Rentnern abtrete, beträgt mein Nettoeinkommen 75% und ich habe 11,25 Jahreseinkommen gespart.
Wenn ich davon 20 Jahre leben muss, bleiben mir pro Jahr 56,25 Prozent eines Jahreslohns. Das sind 75% des Nettolohns zu den aktiven Zeiten. Um – wie im Text angenommem – auf 80% zu kommen, müsste ich 26,1 auf die Hohe Kante legen. Doch diese Zahl suggeriert eine Genauigkeit, die dem simplen Rechenbeispiel nicht angemessen ist. Deshalb die Formulierung von «gut 25%».
Diese Rechnung stimmt auch, wenn wir eine Verzinsung unterstellen, immer vorausgesetzt, der Zins entspricht dem realen Lohnwachstum.
Wenn ich – wie Markus Ursprung vorschlägt – 35% bzw. 15,75 Jahreslöhne auf die hohe Kante lege, komme ich als Rentner auf ein Nettoeinkommen von fast 80 Prozent gegenüber netto 65 Prozent für die Aktiven. Das ist keine sinnvolle Verteilung, weil im (kinderlosen) Alter die Ansprüche eher kleiner werden.
Danke. Jetzt verstehe ich. Und verstehe das Rechenbeispiel ist vereinfacht.