«Krise» der Geisteswissenschaften ist hausgemacht
psi. Dies ist ein teilweise kommentierender Artikel. Der Autor hat mit eigener Erwerbsarbeit und massgeblich dank finanzieller Unterstützung seiner Eltern und seiner Partnerin lange und eher spät geisteswissenschaftliche Fächer studiert.
Kein Wunder waren es Zahlen, die für Aufregung sorgten. Vor wenigen Wochen machte eine Bundesstatistik die Runde, wonach die Studierendenzahlen in geisteswissenschaftlichen Fächern in den letzten zehn Jahren stark gesunken seien. Die Uni Bern etwa teilte Radio SRF mit, dass die Anzahl Studierender an der Philosophisch-historischen Fakultät zwischen 2013 und 2022 um 23 Prozent zurückgegangen sei, während die Studierendenzahlen an der gesamten Universität (ohne Weiterbildung) um neun Prozent gestiegen seien.
Von der Uni Bern hiess es auch: Die Studis würden eben andere Fächer wie Psychologie, Medizin oder Informatik als «gesellschaftlich nützlich» einstufen.
Doch das ist schwierig. Denn nützlich können die Geisteswissenschaften nur schon nicht sein, weil sich ihr möglicher Nutzen unmöglich messen lässt. Sebastian Bonhoeffer, Direktor des interdisziplinären Collegium Helveticum und Professor für theoretische Biologie an der ETH Zürich, sagte vor drei Wochen in der NZZ am Sonntag: «Man soll die Bewertung des gesellschaftlichen Nutzens universitärer Ausbildung anhand von Zahlenwerten nicht überbewerten. Was leicht messbar ist, muss nicht wesentlich sein, aber was wesentlich ist, ist häufig schwer messbar. Das trifft womöglich auf die Geisteswissenschaften mehr zu als auf die sogenannten exakten Wissenschaften.»
Messbarkeitsansprüche erschweren Arbeit
Dass ihre Arbeit seit der Jahrtausendwende immer messbarer sein musste, benachteiligt die Geisteswissenschaften schon länger. Doch weniger aufregend als sinkende Studierendenzahlen waren Hintergrundberichte über die Vergabe von Geldern für Forschung und Lehre und damit vor allem Löhne.
Ein Bericht zur Förderung der Geisteswissenschaften im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Geisteswissenschaften (SAGW) hielt 2015 fest, dass der zunehmende Fokus des Schweizerischen Nationalfonds auf die Finanzierung von eher kurzfristigen Projekten in Teams der Forschungsarbeit in den Geisteswissenschaften nicht entspreche. Die Verhältnisse hätten sich aber etwas verbessert seit der Jahrtausendwende.
Kritik: Nationalfonds bevorteilt Technologiewissen
Kritik am Nationalfonds, der im Auftrag des Bundes eine Milliarde Franken für Forschung verteilt, wird aber immer wieder laut. 2019 forderte die SAGW eine Kursänderung in der Forschungsförderung. Die Disziplinen stünden «im Schatten des MINT-Bereichs und der Life Sciences», der SNF fördere eher ein «technikförmiges Wissen».
2022 evaluierte der Schweizerische Wissenschaftsrat den SNF und musste erhebliche Mängel feststellen. Er konstatierte unter anderem «suboptimale Strategie- und Priorisierungsprozesse» und damit zusammenhängend «das Fehlen von transparenten Governance-Strukturen». Zudem verfüge der SNF über «keine kohärente Portfoliostrategie und keine klaren Kriterien für die Verwaltung und Weiterentwicklung seines Förderportfolios». Übersetzt: Was der SNF tut und wie er dies im Detail macht, ist höchst unklar. Bereits laufende Reformbemühungen sind intern stark umstritten.
Die unpräzisen Strukturen geben den einzelnen Mandatsträgerinnen und -trägern mehr Macht. Doch diese haben kaum Bezüge zu den Geisteswissenschaften. Niemand in der SNF-Leitung hat einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund. Der vom Bundesrat unlängst wiedergewählte Präsident des Stiftungsrats ist Jürg Stahl, ehemaliger SVP-Nationalrat aus dem Kanton Zürich. Er ist gelernter Drogist, hat kein Hochschulstudium absolviert und interessiert sich sehr für Sport. Neben Stahl umfasst der kürzlich neu besetzte Stiftungsrat sechs weitere Personen. Die Persönlichkeiten aus der Wissenschaft haben beeindruckende Lebensläufe vorzuweisen. Doch auch von ihnen ist keine in den Geisteswissenschaften zuhause.
Letztes Jahr kritisierte Sacha Zala, Professor für Geschichte an der Uni Bern den SNF harsch. In der NZZ forderte er gar dessen Auflösung und einen Neuaufbau der Schweizer Forschungsförderung. Die Geisteswissenschaften seien der Bürokratie des SNF ausgeliefert und dieser mache selbstherrlich, was er wolle. Die Unzufriedenheit sei gross, aber sagen wollten das nur wenige offen: «In der Schweiz sind die meisten Forschenden vom SNF abhängig. Niemand sägt am Ast, auf dem er sitzt.»
Politische Nachwuchsförderung und prekäre Arbeit
Eng verwoben mit der Forschungsförderung ist die Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Auch hier fällte der SNF letztes Jahr eine Entscheidung mit Symbolkraft, indem er das Förderprogramm Doc.CH für Doktorierende aus Geistes- und Sozialwissenschaften strich. Sogar in der NZZ stand: «Es ist zu befürchten, dass sich künftig nur noch Studierende mit wohlhabenden Eltern freie und originelle Doktoratsprojekte leisten können.» SNF-Direktorin Angelika Kalt sagte darauf, sie sehe bei den Geisteswissenschaften ein strukturelles Problem an den Hochschulen, das der SNF nicht lösen könne.
Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist allgemein schon länger ein politisches Thema. Dabei ist schon mindestens gleich lange unbestritten, dass Handlungsbedarf besteht. Viele Anstellungsverhältnisse an Hochschulen, die sich an Menschen mit Masterdiplom richten, sind abgesehen von der Befristung schlicht prekär und ohne privaten finanziellen Einsatz kaum zu leisten. Dies trifft nicht erst seit dem Wegfall von Doc.CH besonders auf die Jobs in Geistes- und Sozialwissenschaften zu, wo kaum Geld aus der Privatwirtschaft hinfliesst.
Taten sind auf die Worte und Berichte aus der Politik bisher allerdings nicht gefolgt. Der Bundesrat hat kürzlich in seiner revidierten Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zwar als Schwerpunkt für die Jahre 2025 bis 2028 festgelegt. Doch ob und wie die 20 Millionen Franken dafür ausgegeben werden sollen, muss die Eidgenössische Hochschulkonferenz erst noch entscheiden. Auch hier stehen befristete Projekte im Vordergrund und keine strukturellen Reformen. Gleichzeitig soll der Nachwuchs in mathematisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen gezielt gefördert werden.
Wofür stehen die Geisteswissenschaften?
Besonders in den Sprachfächern lehrt ein geisteswissenschaftliches Studium, wie entscheidend wir uns die Welt gemeinsam über die Sprache erschliessen. Dabei aber auch, dass die Sprache gleichzeitig keinen gegebenen direkten Bezug zu den Dingen hat. Wollten wir uns darauf einigen, könnten wir die Stühle ab morgen Tische nennen. Sprache ist also vor allem Konsens. Geisteswissenschaftliche Forschung kümmert sich im Kleinen um diese Wechselwirkungen. Zum Beispiel: Wie sprechen wir über die Welt? Wie über uns, übers Menschsein? Wie entstehen bestimmte Ideen und Begriffe? Wie haben sie sich im Lauf der Zeit verändert? Und ganz häufig: Wie wirken Ideen und Begriffe?
Deshalb stehen die Geisteswissenschaften für präzisen Ausdruck, differenzierte Kritik und das Bewusstsein, dass ganz, ganz vieles auch nur ganz, ganz wenig anders sein könnte, würden wir anders darüber sprechen, anders lesen, anders wissen. Dieses Bewusstsein kann niemand in Zahlen messen, sondern nur am eigenen Anspruch. Überall da, wo es in konkreten Texten, Bildern, Kunstwerken auftritt, können wir es höchstens vermitteln und damit immer wieder auch kritisieren.
Medienkrise schwächt auch Geisteswissenschaften
Mit den grossen Medien wurde ein wichtiger derartiger Vermittlungsort in den letzten Jahrzehnten stetig geschwächt. Kulturkritik, aber auch Medien- und Wissenschaftsjournalismus erhalten immer weniger Platz. Gleichzeitig wird der verbleibende Kultur- und Gesellschaftsjournalismus zusehends politisierter. Anstelle informierter Auseinandersetzung mit Ideen ist vielerorts die konstruierte Auseinandersetzung zwischen Erzählungen getreten. Grund dürfte auch die Vermessung des Publikums und daraus folgend eine verstärkte Profilierung der einstigen Massenmedien innerhalb politischer Nischen sein.
Zum Beispiel: Anstelle einer Analyse eines inflationär verwendeten Begriffs wie «Populismus», über dessen Bedeutung ganze Bücher geschrieben werden und den Kulturwissenschaftler mittlerweile auch als «strukturell» bezeichnen, tritt ein oberflächliches Verständnis. Dieses kann dann bei der Verwendung des Begriffs in der konkreten politischen Berichterstattung von mehr oder weniger suggerierter Parteinahme bis zur verkrampften Teilnahmslosigkeit viele mögliche Haltungen miteinschliessen. Wer Donald Trump und Bernie Sanders gleichermassen als Populisten bezeichnet, sagt so nicht mehr viel über die beiden Politiker.
Vordergründig bewahren sich damit viele Redaktionen trotz fehlender Ressourcen kritische Distanz. Doch gleichzeitig opfern sie die Genauigkeit der Auseinandersetzung ihrer blossen Beachtung. Wissenschaft, die Künste oder die Medien selber werden so weniger zum Gegenstand kritischer Analyse als zu Objekten im Kampf um Deutungshoheit. Dies verändert auch sie selber, weil sie politisch provokativer sein müssen, um Beachtung zu finden. Verlieren tun letztendlich aber wir alle, die an einem fortlaufenden, ernsthaften, sachlichen Gespräch über unser Zusammenleben interessiert sind.
Dass sich die NZZ am Sonntag kürzlich besorgt fragte, ob die Schweiz angesichts der «Krise der Geisteswissenschaften» das Denken verlernt, war deshalb nicht so abwegig. Dass dabei in einem von vier Artikeln zum Thema aber der zum Kampfbegriff instrumentalisierte «Populismus» als «bewusst vereinfachtes Denken» verstanden und die Abstimmung über die 13. AHV-Rente als «Spitze des Egoismus» taxiert wurde, war auch ein bisschen Symptom der lamentierten «Verkümmerung des Geistes». Als Aufreger eignen sich die Geisteswissenschaften trotz allem weiterhin nur, wenn man sie verbiegt, stutzt oder einpfercht.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Pascal Sigg ist Redaktor beim Infosperber. Er hat in Bern und Zürich Anglistik, Germanistik und Komparatistik studiert und dabei ein Bachelor- und ein Masterdiplom erlangt. Seine Dissertation in Amerikanistik erscheint demnächst im Transcript Verlag. Die Publikation ist finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds.
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.







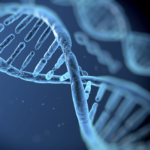


Dieser wunderbare Artikel verknüpft die politisierte Wissenschaft mit politisierten Medien und ich möchte die «Identitätspolitik» (als «politisierte Politik», Parteipolitik) dazu stellen.
Yascha Mounk in der SRF-Sternstunde Philosophie vom 24.03.2024: «Wir brauchen ein überparteiliches und über-ideologisches Bekenntnis zur Redefreiheit, denn niemand weiss, was die politische Situation von morgen sein wird und wer dann plötzlich zum Schweigen gebracht wird.»
Die grosse Masse scheint im Hamsterrad gefangen und kann geistig nicht mehr ausbrechen. Identität wird zum Schutzmantel, um sich «mit all dem Scheiss» nicht mehr auseinandersetzen zu müssen, um eindimensionale Wahrheiten zu finden.
«Verlieren tun letztendlich aber wir alle, die an einem fortlaufenden, ernsthaften, sachlichen Gespräch über unser Zusammenleben interessiert sind.» Danke Herr Sigg.
Ich gratuliere Herrn Sigg zu diesem Artikel. Der Infosperber hat einen ausgezeichneten Chefredaktor, Bravo!
Danke, wir haben allerdings keinen Chefredaktor. Redaktionsleiter ist Urs P. Gasche. https://www.infosperber.ch/redaktion-2/
wie rechtfertigt ein Staat-Land dieses sehr ernste Dilemma? “Hausgemacht“ wie können Ministerien für Bildung und Kultur, universitäre-wissenschaftliche Einrichtungen, abwärts, übrigens nicht nur im deutschsprachigen Raum nachweislich, auch nicht nur in den Geisteswissenschaften, wer will Antworten geben ? Institutsleiter ? Assistenten? OK Verbeamtung kann die Zukunft nicht tragen, auf Zeitverträge wird man sich einstellen dürfen. Geld aus der Privatwirtschaft, bitte mit unabhängiger Kommission auf Prüfung und Veröffentlichung der Zahlungsgebern. Kurzum eine systemimmanente Folgeerscheinung. Aber Politisierung ein Ausdruck der Medienkrise?
Merci für s öffentlich machen.
Solange man «Geistes»wissenschaften noch anführen muss, weil eigentlich, wie in der Illustration gezeigt, Gehirn gemeint ist, solange wird diese Krise nicht überwunden. Solange die Philosophie des Geistes den Bückling vor den Neurowissenschaften macht und man sich von Aussagen wie «Das Gehirn denkt» nicht entschieden und gut begründet distanzieren kann, solange wird man sich schon fragen müssen, ob die Schweiz das Denken verlernt hat. Aber diese Frage richtet sich eigentlich nicht an eine einzelne Nation, sondern an unsere gegenwärtig dominante Auffassung dessen, was Geist, was Denken, was Bewusstsein, was Seele sei.