Kommentar
«Er hauchte ‹Ne me quitte pas› – und verliess Frau und Töchter»
Eine neue Sportart greift seit einiger Zeit um sich: Das lustige Abschiessen von Künstlern, seien es Bühnendarsteller oder Schriftsteller, seien sie lebend oder tot, die einer moralischen Unkorrektheit in ihrem privaten Leben für schuldig befunden werden. Ihr Konterfei wird in Schiessbuden zum Abschuss freigegeben, und diese Schiessbuden sind zum Beispiel die Tamedia-Zeitungen «Tages-Anzeiger», «Berner Zeitung» oder «Basler Zeitung»
Ab 9. Dezember publizierten diese Zeitungen einen Aufsatz, mit dem der belgische Chansonnier Jacques Brel vom Sockel gestossen werden sollte. Brel macht sich nämlich an einem Tag im Juni 1953 «auf den Weg von Brüssel nach Paris, der grossen Karriere entgegen.» Er verlässt seine hochschwangere Frau Thérèse, um dahin zu gehen, «wo er zum neuen Stern des französischen Chansons aufsteigen sollte.»
So skrupellos war er also, dieser Brel. Das enthüllt uns in den Tamedia-Zeitungen SZ-Redaktor Josef Kelnberger. Damit wir Bescheid wissen, bevor wir weiterlesen, steht zuoberst ein Foto, auf dem Jacques Brel 1961 auf der Bühne zu sehen ist, und darunter die Bildlegende: «Eroberte die Musikwelt, vernachlässigte die Familie». Gleich daneben das fettgedruckte Zitat von France Brel, einer seiner Töchter: «Mein Vater hat zu Lebzeiten nie seiner Familie, sondern immer anderen gehört. Und nach seinem Tod war es wieder so.»

Falls es noch weiterer Beweise für die Schuld des Angeklagten bedürfte, so finden sie sich angeblich eindeutig im Widerspruch zwischen Leben und Werk. Der Mann hat auf der Bühne gesungen: «Ne me quitte pas», verlass mich nicht, ein Lied, das vom Pariser Olympia bis zur New Yorker Carnegie Hall um die Welt ging. Und was tat er im wirklichen Leben hinter der Bühne? Der Brel-Enthüller weiss es:
«Jacques Brel hat sein Leben lang Menschen verlassen, seiner Kunst und seinem Lebenshunger folgend, als Sänger und Autor, als Schauspieler und Regisseur, als Flugzeugpilot und Weltumsegler, als Liebhaber, immer auf der Flucht vor der sterbenslangweiligen Bürgerlichkeit…»
Dem Autor dieser Polemik, Josef Kelnberger, unterläuft dabei ein Logik-Fehler, der jeder Sprach- und Literaturstudentin spätestens im zweiten Semester bekannt ist: Ein Sänger ist nicht identisch mit den Figuren, die er auf der Bühne darstellt. Die Fiktionen eines Autors sind nicht seine Autobiographie. Und die Figuren, die ein Jacques Brel auf der Bühne zum Singen bringt, sind nicht Jacques Brel. Sie sind seiner Vorstellungskraft entsprungen, aber es sind gespielte Rollen.
Wieweit sie eine Schnittmenge haben mit dem wirklichen Leben eines Jacques Brel, ist ein literaturtheoretisches Problem. Man kann in den Texten eines Künstlers viele Faktoren suchen: Biographisches, Psychoanalytisches, Politik oder den Zeitgeist. Absurd und von grosser Dummheit ist dagegen die Forderung nach Kongruenz zwischen seinem Leben und dem, was er auf der Bühne singt. Die moralische Keule, die da konstruiert wird, kennzeichnet die neue Woke-Moral, die alten, weissen Männern an den Kragen geht.
Es erscheint erstaunlich, dass hochqualifizierte Kulturredaktionen wie diejenige der grossen Tamedia-Zeitungen dies zu ignorieren vermögen. Oder kapituliert man auch dort unter dem Druck der Woke-Erleuchteten?
Wenn es etwas gibt, das den sozialen Typen, die Brel als Chansonnier auf der Bühne spielte, nicht zu eigen ist, dann ist es moralische Sauberkeit. Eines der Lieder, mit denen er 1965 auf Tournee ging, war «Le dernier repas». Es ist der gesungene letzte Wille eines patriarchalischen und (sehr französisch) anarchischen Bauern, der bei seiner letzten Mahlzeit seinen Esel sehen will, seine Hühner und Gänse, seine Kühe und seine Frauen. In dieser Reihenfolge. Wenn er dann vom guten Wein aus Arbois «genug im Ranzen hat, um die Welt zu ertränken», dann wird er die Erinnerungen seiner Kindheit in der Pfeife rauchen und sein Glas zerbrechen: «pour faire le silence.» Und wenn der Moment kommt, in dem es aussen und innen dunkel wird, will er «noch einmal Steine gegen den Himmel werfen, und schreien: Gott ist tot.» Und der letzte Satz lautet, er wisse, dass er dann Angst haben werde, «une dernière fois».
Die meisten Lieder von Jacques Brel werden die neuen Hüter einer moralischen Reinheit und Korrektheit zum Hyperventilieren bringen. Er hat alles gesungen, was er als Varianten des Menschseins erfahren konnte, die Ängste und Wahnvorstellungen, die kleinbürgerlichen Lügenfassaden, die Erniedrigung des Alterns, die Attitüden der Reichen und Etablierten, das Hässliche und das Lächerliche, aber auch die Erlösung des Menschen durch Momente der grenzenlosen Zuneigung und Geborgenheit.
Zum Letzteren gehört «Mon plat pays» (1962), ein Lied über Flandern. Ich kenne keinen Text in französischer Sprache, der mit so wenigen, schlichten Worten eine solche poetische Dichtheit und Kraft erzeugt, um eine Landschaft und das Lebensgefühl ihrer Menschen zu zeichnen. Ein kleines Lied. Und grosse Literatur. Aber auch eine grosse Versöhnung mit seinem zwischen Wallonen und Flamen zerrissenen Heimatland.
Nun ist die neue Gesinnungspolizei bei ihrer Suche nach auffälligen Künstlerinnen und Künstlern also auf Jacques Brel gestossen. Die Razzia, die die Neomoralisten in der Galerie der grossen Künstlerinnen und Künstler durchführen, wird noch eine Menge alter Männer aufspüren, die von ihrem Sockel in die moralische Jauchegrube gestürzt werden müssen.
Sehr aufschlussreich ist indessen, dass der Verfasser des Brel-Pamphlets wohl selbst nicht sicher ist, ob seine Thesen stimmen. Denn er hat immerhin die journalistische Professionalität zu erwähnen, dass die von ihm als Zeugin angeführte Brel-Tochter letztes Jahr in einem Interview mit einer belgischen Zeitung «die Legende zertrümmert, wonach Thérèse Brel in mütterlicher Fürsorge die Familie zusammenhielt, während der Vater seiner Wege ging». Ihre Mutter sei eine kalte und gefühllose Frau gewesen, sagt France Brel dort, nur interessiert am Geld, das der Mann überwies, am Shoppen und am Golfspielen.
Wie dem auch sei, es ist, wie oben gezeigt, für die Beurteilung der künstlerischen Qualitäten eines Jacques Brel unerheblich, ob er Thérèse verliess oder sie ihn, ob es eine gute oder schlechte Beziehung war, ob er «Lebenshunger» und Geliebte hatte, ob er der «sterbenslangweiligen Bürgerlichkeit» entfliehen wollte und so weiter. Der Versuch, mit derartigen Klischees eine Figur wie Brel moralisch zu demontieren, ist stupide, aber er kennzeichnet den Irrsinn des Zeitgeistes.
Die neue moralische Inquisition wird mit rabiatem Eifer betrieben und hat offensichtlich erheblichen Einfluss in unseren grossen, führenden Medien gewonnen. Was nicht dem korrekten Design entspricht, muss entsorgt werden. Das Ideal ist offenbar, eine ideologisch homogene Gesellschaft herzustellen. Brel war der lebendige Widerspruch zu allen Tabus und Reinheitsgeboten einer Cancel Culture.
Er war eine Urgewalt des Chansons, sowohl in der Qualität seiner Texte als auch in seiner Ausdruckskraft auf der Bühne. Für viele Menschen seiner Zeit wurden seine Lieder ein Leben lang Trost, Zuflucht und Philosophie. Er kam bei seinen Auftritten oft an die Grenze seiner psychischen und physischen Kraft, aber er brauchte auch das Delirium der Zuschauer in vollen Sälen. Wenn Leidenschaft leiden heisst, dann wundert es nicht, dass er mit 49 gestorben ist.
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine
_____________________
Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.





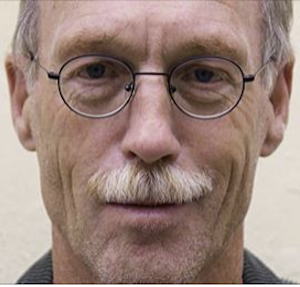




Welchen Differenzierungsanspruch und zusätzlichen Informationsgewinn die neurechten Kampfbegriffe „Woke-Ecke“ und „Gesinnungspolizei“ auch immer haben sollen.
Die Kritik mag ja durchaus berechtigt sein – und doch ist diese Art von Repliken mittlerweile auch ermüdend langweilig: „Woke-Erleuchteten“, „Gesinnungspolizei“, „Brel-Pamphlet“, „Irrsinn des Zeitgeist“, „moralische Inquisition“… Uff.
Das Gegenteil von schlechtem Journalismus kann doch nicht eine solche Schlagwortsuppe sein, bei der einfach die Vorzeichen umkehrt werden: Wie du mir, so ich dir? Das gleiche Rezept wendet seit längerem ja auch die NZZ an, um gelangweilte Rentner zu triggern, was bei mir – wie auch hier – höchstens noch einen Gähnrefkex aus. Was in diesen Zeiten eher fehlt, ist eine nüchterne journalistische Gemächlichkeit – eine Antipode zur Polemik.
Es wundert nicht, dass nun auch moralisierende «Kultur-Journalisten» immer mehr solche Klatschgeschichten-Ergüsse als Sensatiönchen zum Besten geben müssen, um ja seinen Arbeitgeber zufrieden zu stellen, geht es hier doch schlicht und einfach darum, den allgemeinen Abwärtstrend dieser Presseerzeugnisse zu bremsen zu versuchen. Und an Publikum, dass nicht mehr selber denken vermag, mangelt es offensichtlich nicht. Tragisch.
«Hochqualifizierte Kulturredaktionen» bei den Tamedia-Zeitungen? Das war mal, z.B. zu Zeiten von Laure Wyss. Aber heute? Quantité négligeable.
Herzlichen Dank an Helmut Scheben für diesen liebevollen Kommentar. Als bekennender Brel-Fan tun mir Ihre Zeilen in der Seele gut. In der sich ausbreitenden moralischen Wüste wenigstens ein Tropfen auf einen heissen Stein. Mir selber ist dazu ein Text unter dem Titel Der neue Mief eingefallen. Will heissen, wir sind im freien Fall zurück in die Zeit, als man mit Vati mit Stumpen am Steuer und Mutti im Festtagskleid daneben, auf dem Rücksitz im Opel Kapitän – unter der Heckscheibe das obligate Kissen mit der gehäkelten Autonummer, Schweizer Kreuz und Kantonswappen inklusive – auf Sonntagsfahrt ins Emmental war. Um spätnachmittags, Merängge unterwegs ausgekotzt, und Vati mit 1,2 Promille intus, im Reihenhäuschen zu landen, wo Mutti die Woche über sorgsam den Mief unter den Teppich gekehrt hatte. Weder ein Stäubchen unkatholischer Unmoral noch ein Hauch unbürgerlicher Widersprüche störten das Idyll. Dafür drohte der geistige Erstickungstod im Mief des aufziehenden Kalten Krieges.