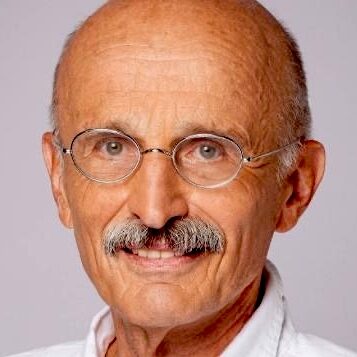Kommentar
Igitt! Das grenzt ja an Populismus!
Auf Argumente kann man eingehen, sie diskutieren und allenfalls mit Gegenargumenten entkräften. Man kann ihnen aber auch einfach ein Etikett ankleben und die Moralkeule schwingen: «Da ist ja der reinste …ismus. Da weiss man ja wie das endet.» Eine häufig vorkommende Variante dieser Strategie ist kürzlich in einem Artikel in der NZZ angewandt worden.
Der amerikanische Historiker Barry Eichengreen hat 200 Jahre Wirtschaftsgeschichte durchgekämmt, um den Populismus zu verstehen und dessen Wurzeln freizulegen. Seine Erkenntnisse hat er in einem 260 Seiten dicken Buch mit dem Titel «Die Versuchung des Populismus» * niedergeschrieben. Lukas Sustala hat das Buch in der NZZ besprochen. Zwischen den 120 Zeilen seines Textes werden spätere Historiker herauslesen können, mit welchen semantischen Tricks die Sieger der Globalisierung den Verlierern den Dialog verweigert haben.
Der Nährboden des Populismus
Schon der Titel macht das klar: «Wut verwandelt sich in Politik». Das Wort Wut kommt in dem kurzen Text fünfmal vor. Aus der Psychologie wissen wir: Wer wütend ist, denkt nicht. Er handelt, wird handgreiflich, argumentiert nicht, sondern schreit. Dass sie der «populistischen Versuchung» erliegen, ist eine weitere Charakterschwäche, die man kennen muss, wenn man mit Populisten Umgang pflegt. Ferner erfährt der Leser, dass der Populismus dort gedeiht, wo die «spaltende Saat einen fruchtbaren Nährboden findet, dessen von links und rechts emporschiessenden Gewächse in Europa und in den USA oft unterschiedliche Wurzeln haben».
Was ist denn nun der Nährboden, worauf diese spaltende Saat gedeiht? Eichengreen vermutet, dass «die Globalisierung, die Automatisierung oder die Immigration für den Nährboden des Populismus» von Bedeutung seien. Der gemeinsame Nenner sei «die Wahrnehmung eines wachsenden Teils der Gesellschaft, abgehängt zu sein». Das sei schon bei den Maschinenstürmern so gewesen. Eichengreen räumt ein, «dass der Einsatz moderner Technologien, intensivere Handelsverflechtungen mit Niedriglohnländern oder steigende Zuwanderung in dieselbe Richtung wirken: nämlich dahingehend, dass sie zu mehr Wohlstand, mehr Wettbewerb, aber auch zu mehr Ungleichheit beitragen, was Verlierer ebenso wie Gewinner hervorbringt». Populisten wie «Luigi Di Maio, Recep Tayyip Erdogan oder eben Donald Trump» gelinge es dann, die Wut dieser Verlierer zu kanalisieren. Auch der Brexit lasse sich so erklären.
Verlierer und Gewinner der Globalisierung
Damit sind wir beim Kern des Problems: Die Globalisierung, die Einwanderung, der Einsatz moderner Technologien und die intensive Handelsverflechtung mit Niedriglohnländern bringen Gewinner und Verlierer hervor. Es ist auch keineswegs sicher, dass diese Kräfte wenigstens per Saldo zu mehr Wohlstand führen. Da ist es nur natürlich, dass die Verlierer und dem Allgemeinwohl verpflichtete Politiker nach Lösungen suchen, die Schäden zu begrenzen. Der NZZ ist das verdächtig: «Jetzt warnen europäische Populisten am linken und rechten Rand des politischen Spektrums vor der drohenden Schieflage der Sozialsysteme, wenn die Zuwanderung unkontrolliert oder zu sehr im Bereich unqualifizierter Migration erfolgt.»
Merke: Wer Einschränkungen des freien Personen- und Warenverkehrs, oder einen Ausbau des Sozialstaates fordert, wird als Populist entlarvt – womit sich ein Eintreten auf die Sachfrage erübrigt. Eichengreen argumentiert in diesem Punkt allerdings differenzierter. Er erachtet die Forderung nach Umverteilung, wie sie etwa im «New Deal» in den USA zum Ausdruck gekommen sei, nicht als populistisch. Was der NZZ natürlich nicht gefallen kann. Eichengreen «schüre», so die NZZ, «die Hoffnung, ein besser ausgebauter Wohlfahrtsstaat löse die Probleme des Populismus.»
Man bemerke den kleinen aber feinen Unterschied: Während es bei Eichengreen noch darum geht, ob und wie die Verlierer entschädigt werden könnten, wendet sich die NZZ der offenbar viel dringenderen Frage zu, ob sich der Wohlfahrtsstaat dazu eigne, dem Gespenst des Populismus Einhalt zu gebieten. Doch das kann er – laut NZZ – leider nicht. «Das zeigen die erfolgreichen populistischen Strömungen in Ländern mit gut ausgebautem Wohlfahrtsstaat. Nicht der Wohlfahrtsstaat taugt langfristig als Abwehr gegen die populistischen Bewegungen, sondern ein mündiges Elektorat und starke demokratische Institutionen, die sich gegen vermeintlich populäre Schnellschüsse und einen medialen Herdentrieb wehren können.»
Auch hier scheint wieder das bekannte Muster durch: Hier das mündige Elektorat, dort die nur vermeintlich populären Schnellschüsse und der mediale Herdentrieb. Auch ein anderes Muster wird erkennbar: Wenn der Experte Eichengreen nicht genau das sagt, was man hören will, zitiert man einen anderen. Sustala greift zu diesem Zweck auf den deutsch-amerikanischen Ökonomen Rüdiger Dornbusch zurück, «der 1990 das wirtschaftspolitisch-populistische Paradigma messerscharf analysierte. Und zwar als Politik, die kurzfristiges Wachstum und Verteilungsfragen in den Fokus nimmt und langfristige Gefahren von Inflation und Überschuldung kleinredet; als Politik, die lieber heute Geld verteilt und alle externen Beschränkungen bestenfalls ignoriert».
Damit wissen wir auch, warum die Schnellschüsse nur vermeintlich populär sind: Umverteilung und Protektionismus schaden langfristig mehr als die nützen. Das weiss «man» ja, darüber muss man auch gar nicht erst diskutieren. Zur Not reicht es, einen wie den grossen alten Rüdiger Dornbusch zu zitieren, der das auch schon mal gesagt hat. Bloss die Populisten wollen es nicht wahrhaben. Darum: Wehret den Anfängen, eh es zu spät ist.
—-
* Barry Eichengreen: The Populist Temptation. Economic Grievance and Political Reaction in the Modern Era. Oxford University Press, New York 2018. 260 S., CHF 39.90
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine.