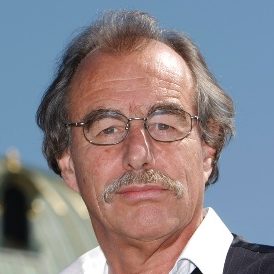Kommentar
Schweiz bleibt punkto Militär ein Vorbild
Red. Dieser Kommentar ist eine Duplik auf die Beiträge von Adolf Ogi, Oswald Sigg, Bruno Lezzi und Josef Lang. Siehe Dossier «Die Sicherheitspolitik der Schweiz».
—
Das Wichtigste aktuell vorab: Das Schweizer Volk wird am 22. September die verfehlte «Wehrpflicht-Initiative» klar ablehnen. Es will keine Berufsarmee, die sich in Friedenszeiten auf Waffenplätzen langweilt – darum auf irgendwelche Kriegsschauplätze in der weiten Welt drängt, und im Notfall dann das Land niemals verteidigen könnte. Es will auch keine Rambolino-Truppe aus freiwilligen, aber gut bezahlten Jugendlichen. Und es will vor allem das friedenspolitisch fortschrittliche und sehr erfolgreiche Schweizer Wehrsystem nicht destabilisieren. Verfehlt ist die Initiative auch darum, weil es ihren Urhebern, der GSoA, gar nicht um die Wehrpflicht geht: Sie wollen nicht eine «freiwillige Milizarmee», wie sie vorgeben, sondern gar keine Armee. Wären sie ehrlich, würden sie eine neue Abschaffungs-Initiative bringen. Sie wissen jedoch, dass dies erst recht keine Chance hätte.
Viel Feind viel Ehr
Für den momentanen Schweizer Wehrminister Ueli Maurer (SVP) ist diese Abstimmung eine wichtige Sache – wichtiger als der Gripen jedenfalls. Und wie schon bei der Initiative gegen «das Gewehr im Schrank» wird er mit seinem politischen Geschick auch diesmal gewinnen. Ich habe die nach meiner Überzeugung sehr erfolgreiche und gekonnt auf das Wesentliche konzentrierte Sicherheitspolitik Maurers an dieser Stelle dargestellt und beschrieben.
Und siehe da: Mit Oswald Sigg und Robert Ruoff traten gleich zwei ehemalige Beschäftigte des früheren Schweizer Verteidigungsministers Adolf Ogi (SVP) zu dessen Verteidigung an. Danach auch noch Ogi selber. Da könne man fast sagen: «Viel Feind, viel Ehr!» Die Beiträge von Bruno Lezzi und von Josef Lang zum Thema runden das ganze zu einer sehr interessanten Serie ab.
Nichtangriffsfähigkeit ist Friedenspolitik
Dabei wurde allerdings Verschiedenes vermischt und verwechselt – und wichtiges Historisches vergessen. Zum Beispiel dies: Das letzte Schweizer Kriegsabenteuer über die Landesgrenzen hinaus war nicht etwa das Fiasko von Marignano Mitte September 1515, sondern der eidgenössische Feldzug über Porrentruy in den französischen Jura hinaus genau 300 Jahre später im September 1815: Die opportunistische Führung der Eidgenossenschaft witterte damals nach Napoleons finaler Niederlage bei Waterloo (18. Juni 1815) ein «window of opportunity», um beim allgemeinen Schlachten in Europa auch noch ein wenig mitzumachen – und dann bei der Verteilung der Beute mit dabei zu sein.
Doch diese «Intervention» endete ebenso übel, wie viele solche zuvor und danach: Schon bei Delémont lief die halbe Truppe davon, weil der Schweizer Oberkommandierende Niklaus Franz von Bachmann den Sold nicht mehr bezahlen konnte. Und nach einigen missglückten Scharmützeln nur unweit jenseits der Grenze bei Pontarlier war es dann für immer vorbei mit gewalttätig militarisierter Schweizer Aussenpolitik, vorbei mit Reisläuferei, Söldnerausbeutung und Beresina («Pfyffelampenöl!»).
Im selben Jahr nämlich bekannte sich unser Land hochoffiziell zur immerwährenden, bewaffneten Neutralität. Konkret: Der Mehrvölker-Kleinstaat mitten in Europa würde fortan Militär nur noch notfalls zur Selbstverteidigung aufbieten. Seine Armee, die sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konkretisieren sollte, müsste «strukturell nichtangriffsfähig» im eigenen Gelände bleiben. Das war eine friedenspolitische Revolution.
Weitsichtige Leute, fortschrittliches Konzept
Aber es sollte noch viel besser kommen: Weitsichtige Leute – vom genialen General Guillaume-Henri Dufour (»Il faut sortir de cette lutte non seulement victorieux, mais aussi sans reproche!») bis zu den 1848er Liberalen – bauten diese faktische Absage an den Krieg nach 1848 zu einem Gesamtkonzept fortschrittlicher Friedenspolitik aus. Zentrales Element dieses Konzeptes: Militär und Krieg sind seither nicht mehr ein Instrument der (Aussen-) Politik in der Hand der Schweizer Regierung – sondern nur noch im höchsten Notfall zur Verteidigung des Landes. Schon damals war also die «beste Armee der Welt» nicht etwa jene, welche weltweit am meisten «Feinde»vernichtet und Infrastruktur zerstört. Sondern jene Armee, die den Krieg gar nie führen muss und will, weil sie ihn durch ihre potenzielle Präsenz vom Land abhält und ihm erspart. Die fortschrittlichen Armeeplaner von 1848 hatten schon damals erkannt, was die Jungsozialisten ihren SP-Parteiobern erst kürzlich (ohne viel Erfolg) in Erinnerung riefen: «Die Welt erwartet von der Schweiz sicher nicht noch mehr bewaffnete Soldaten!»
Überlegene Schweizer Militärkonzeption
Doch die «strukturelle Nichtangriffsfähigkeit», die sich vorab in der einfachen und national ausgerichteten Logistik zeigt, ist nur ein Element der seither geltenden, friedfertigen Schweizer Militärpolitik. Weitere wichtige Elemente sind die allgemeine Wehrpflicht und das Milizprinzip. In der Bundesverfassung schlugen sie sich im Verbot des Söldnerwesens einerseits und im Verbot, stehende Truppen zu unterhalten, andererseits nieder.
Dass unser Land diesen grossen Entwicklungsschritt hin zu weniger Krieg und mehr Frieden schon vor bald 200 Jahren schaffte, ist erstaunlich und ein Glücksfall. Militärpolitisch rückständigere Staaten wie etwa Deutschland folgten noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein (und teils bis heute – oder schon wieder) dem dummen Spruch: «Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.» Der Spruch verschleiert, dass mit «anderen» in Tat und Wahrheit «gewalttätige, menschenverachtende und zerstörerische» Mittel gemeint sind. Wohin derlei «Fortsetzung der Politik» führt, sollte sich im Ersten und im Zweiten Weltkrieg auf grässlichste Weise zeigen. Neuerdings kann man es in den nachhaltig zerstörten Ländern Afghanistan und Irak beobachten.
Beispielloser Erfolg der Schweizer Armee
Das Elend der weltweit operierenden Besatzungstruppen zeigt sich dabei bis heute nicht nur in den zerstörten Ländern, die sie angreifen, sondern auch in den Tausenden von psychischen und physischen Krüppeln, die aus solchen «Interventionen» heimkehren. Die Machthaber in den immer noch kriegführenden Ländern kümmert dies wenig: Sie hocken sicher in ihren klimatisierten Büros in Moskau, Berlin, Washington, London oder Paris und reden auch die schlimmsten Niederlagen schön. Jetzt gerade wieder die Schlamassel in Afghanistan und Irak, die sie angerichtet haben: Ihre mit hunderten von Steuer-Milliarden hochgerüsteten Armeen sind dort vom minimal bewaffneten, aber im eigenen Gelände stark verankerten Widerstand mit Ausdauer und Geschick geschlagen worden. Jetzt jammern diese «globalen Neomilitaristen», wie Josef Lang sie treffend nennt, scheinheilig über «failed states». Dabei haben sie diese «gescheiterten Staaten» mit ihren gewalttätigen weltweiten Einmischungen nicht selten selber mit verursacht.
Im Unterschied dazu blickt die rein defensive Schweizer Armee seit 1848 bis heute auf eine beispiellose Erfolgsgeschichte zurück, um die uns die Menschen in unseren Nachbarländern zu Recht beneiden. Dieser Erfolg beruht auf der Einsicht, dass Waffengewalt und Krieg das Schlimmste ist, was den Menschen geschehen kann. Darum keine stehenden Truppen in der Hand der Schweizer Regierung. Und nur im schlimmsten Notfall Mobilisierung.
Denn es geht ums Töten und darum, sein Leben zu riskieren. Und das delegiert der hochentwickelte Rechtsstaat nicht leichtfertig an bezahlte arme Teufel, an Söldner oder Waffennarren, sondern an seine eigenen Bürger mit ihrer persönlichen Waffe, an der sie ausgebildet sind. Rosa Luxemburg hat schon vor dem Ersten Weltkrieg erkannt, das dies die einzige staatspolitisch noch vertretbare Form des Militärs ist: «An erster Stelle fordern wir die Volkswehr an Stelle des stehenden Heeres», schrieb Luxemburg als Chefredaktorin der «Leipziger Volkszeitung» am 1. Juni 1911 unter dem Titel «Die neue Armee». Diese Armee solle «dem Milizsystem folgen» und «allein zu Verteidigungszwecken gegen den äusseren Feind» eingesetzt werden. Die prominente Linke warnte: «Ohne die Auslieferung der Waffe an alle Wehrfähigen» sei «der wesentliche Punkt der Volkswehr» verfehlt.
Historisch bewusste Linke im Land halfen darum am 13. Februar 2011 auch mit, die einseitig gegen Armeewaffen gerichtete «Waffeninitiative» an der Urne abzulehnen.
Gefährliche «windows of opportunity»
Auch da hat das Schweizer Volk nicht am gut austarierten und friedenspolitisch fortschrittlichen Schweizer Militärkonzept rütteln lassen. Und der Erfolg dieses Systems gibt ihm seit über 100 Jahren recht: Weder im Deutsch-Französischen Krieg noch im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg nahm unser Land grösseren Schaden. Aus den üblen Kriegen in Irak und Afghanistan konnte sich die Schweiz trotz allem Drängen der globalen Neomilitaristen im In- und Ausland weitgehend heraushalten.
Dabei gab es immer wieder «windows of opportunity», durch welche Opportunisten in der Armee und in der Politik unseres Landes vom friedfertigen Schweizer Erfolgskonzept abrücken wollten. Im Ersten Weltkrieg etwa Generalstabschef Theophil Sprecher von Bernegg. Später einzelne Bundesräte und ganze Gruppen von Offizieren. Ihre Argumente waren meist die selben: Es sei eben jetzt «eine neue Zeit». Oder: «Willkommen in der Realität.» Und sie versuchten die erfolgreiche Schweizer Milizarmee als «Grossvaterarmee» runterzumachen.
Doch sie blieben politisch stets in der Minderheit. Ein wichtiges Element der sicherheitspolitischen Stabilität und Verlässlichkeit der Schweiz ist nämlich die direkte Demokratie: Dass sich die Schweiz aktuell etwa nicht am fragwürdigen Piratenkrieg vor Somalia beteiligt, ist vorab das Verdienst Ueli Maurers. Aber auch des Schweizer Parlaments, das genau gemerkt hat, dass solche Abenteuer im Volk nie eine Mehrheit finden könnten. Und auch darum wird die Schweiz benieden: Könnten die Menschen in jenen Ländern abstimmen, deren Machthaber weltweit Kriege führen, würden die meisten Besatzungstruppen (die sie mit ihren Steuergeldern finanzieren müssen) sofort den Rückzug antreten. Keinem vernünftigen Deutschen käme es jedenfalls in den Sinn, sein Land müsse nun «am Hindukusch verteidigt» werden.
Ogis geheime «Programme» zur Nato-Anpassung
Dessen wohl bewusst, haben auch Schweizer Politiker etwa mal wieder versucht, heikle Volksabstimmungen zur Sicherheitspolitik zu vermeiden. So auch kurz vor 1999, als die US-Regierung ihr schlaues Nato-Programm «Partnership for Peace» (PfP), mit dem es zahlreiche Länder ausserhalb der Nato anbinden wollte, dem damaligen Schweizer Militärminister Adolf Ogi durch sein «window of opportunity» zur Unterschrift entgegen streckte: Ogi wolle die Nato-Partnerschaft «am Volk vorbei schmuggeln», schrieb ich damals im TagesAnzeiger. Der SVP-Wehrminister und seine Mediensprecher protestierten und dementierten vehement. Nicht beim Schreibenden als zuständigem Journalisten, sondern auf oberer Ebene bei Chefredaktion und Verleger. Mit wenig Erfolg. Und ich behielt recht: Über die Nato-Partnerschaft der Schweiz durfte das Schweizer Volk nie abstimmen.
Diese Partnerschaft war auch nicht eine Idee Ogis oder Flavio Cottis gewesen, der als Bundespräsident den Vertrag mit unterschrieb: Es war der damalige US-Verteidigungsminister William Perry, der persönlich in Bern den Bundesrat vehement dazu gedrängt hatte, die «Partnerschaft» mit der von seiner US-Regierung kontrollierten Nato einzugehen. Als Ogi dann das Konzept seiner Nato-kompatiblen und mit Nato-Truppen «interoperablen» Armee XXI vorstellte, sass im Zimmer 87 des Bundeshauses zwischen den Journalisten auch der US-Militärgesandte im Saal und beobachtete, ob alles in seinem Sinne aufgegleist sei.
Ogi hatte mit der Nato und den USA auch ein «Programm» namens «Interoperability Objects for Switzerland» vereinbart, gemäss dem die Anpassungsschritte seiner Armee XXI an Nato- und US-Standards jährlich von US-Offizieren neu überprüft wurden (Partnership and Revue Programm PaRP). Und schon diese «Programme» wurden auf Wunsch der Amerikaner von Ogi verheimlicht: Die englischen Original-Berichte über die Anpassungs-Programme wurden nie veröffentlicht. Das erinnert fatal an jenes geheime US-«Programm» für Schweizer Banken, das die eidgenössischen Räte zum Glück nun abgelehnt haben.
Gescheiterte Nato-Armee XXI
Heute ist klar, dass «Partnership for Peace» (PfP) und die Nato-kompatible Armee XXI nie «eine Chance» oder im Interesse der Schweiz waren. Man könnte gar von einer raffinierten Falle der Nato reden, was sich eigentlich schon im Etikettenschwindel «Partnerschaft für den Frieden» zeigt: Der Atlantikpakt führt weltweit mehrere Kriege. Richtig müsste es also heissen: «PfW, Partnership for War.» Mit nur hauchdünner Mehrheit hat zwar das Schweizer Volk 2001 dennoch der Bewaffnung von Schweizer Soldaten im Ausland zugestimmt. Und die vorausgegangene Kampagne war damals tatsächlich «schmierig» gewesen, wie Josef Lang schön aufzeigt: Der rechte SP-Flügel hatte sich jedenfalls schamlos von der UBS schmieren lassen.
«Bewaffnete Truppen im Ausland»: Das war nach der Nato-PfP und der angepassten Armee XXI das dritte Element der damaligen, unausgegorenen Abkehr von der erfolgreichen und fortschrittlichen Schweizer Militär-Konzeption und hin zur schleichenden Nato-Integration. Ein Rückschritt hin zum gefährlichen Versuch einer Re-Militarisierung der Schweizer Aussenpolitik nach 200 Jahren Frieden im Land.
Burkhalters gefährliches Spiel
Aber das alles ist zum Glück gescheitert und Geschichte. Die Akteure von damals, Ogi, Lezzi und Sigg, sind im Ruhestand. Die Akteure von heute, allen voran Bundesrat und Wehrminister Ueli Maurer sind am Reparieren und am Aufräumen. Und die grosse Mehrheit der Leute im Land weiss wieder sehr wohl, wie wichtig die Neutralität, das flexible Milizprinzip und der konsequente Verzicht auf militärische Machtmittel in Friedenszeiten für die Schweiz sind. Das müsste eigentlich auch unser aktueller Aussenminister Didier Burkhalter (FdP) zur Kenntnis nehmen. Er will im Rahmen seiner Bilateralen III die Schweiz und ihre Armee auch in die Militärarchitektur der arg angeschlagenen EU mit einem «Rahmenabkommen» integrieren. Das ist ein gefährliches Spiel: Entweder probiert Burkhalter dieses Ansinnen ebenso am Volk vorbei zu schmuggeln, wie seinerzeit Adolf Ogi seine Nato-PfP. Oder eine böse Schlappe an der Urne kann ihm jetzt schon vorausgesagt werden.
—
Zum Dossier «Die Sicherheitspolitik der Schweiz»
—
Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors
Keine. Der Autor verfolgt die Schweizer Sicherheitspolitik als Journalist im Bundeshaus seit Jahrzehnten.